Schweiz, April 2025: Scheinbar aus dem Nichts kündigten die Vereinigten Staaten von Amerika Einfuhrzölle in Höhe von 31 Prozent auf eine Auswahl Schweizer Produkte an.
Die Begründung klang vertraut und beinahe banal: Handelsungleichgewicht. Die Schweiz exportiere zu viel in die USA, importiere zu wenig.
Die Balance sei gestört. Fairness sei herzustellen, zur Not mit Zwang.
Die Reaktion in Bern war routiniert höflich: Irritation, diplomatisches Bedauern, der Verweis auf Verhandlungskanäle.
Doch hinter dieser aufgesetzten Gelassenheit steckt eine unbequeme Wahrheit: Die USA operieren mit Zahlen, die nicht mehr zur Wirklichkeit gehören, und die Schweiz lässt es geschehen.
Denn die offizielle Handelsbilanz, auf die sich Washington beruft, basiert auf einem Messsystem, das den Wandel der letzten zwei Jahrzehnte nicht nachvollzogen hat.
Es zählt Container, Warenzölle, physische Exporte und übersieht das, was heute tatsächlich die Ströme bestimmt: Dienstleistungen, Plattformen, Algorithmen, digitale Nutzung.
Kurz gesagt: den digitalen Handel, insbesondere jenen aus den USA in die Schweiz.
Die Vorstellung, dass die Schweiz ein Nettoexporteur gegenüber den USA sei, ist tief im politischen Denken verankert, gestützt auf sichtbare Wahrheiten:
Schweizer Medikamente in Boston, Schweizer Uhren in San Francisco, Schweizer Käse auf Märkten in Chicago.
Diese Exporte sind real, hochwertig und teuer. Aber sie sind nicht allein ausschlaggebend für die wirtschaftliche Wahrheit.
Denn während die Schweiz ihre Waren verschifft, importiert sie gleichzeitig, ohne es offiziell zu erfassen, einen gewaltigen Strom an digitalen Leistungen aus den Vereinigten Staaten.
YouTube-Werbung für Zürcher Firmen. Microsoft-Cloudlösungen für Basler Pharmaunternehmen. Instagram-Targeting für Genfer Modehäuser.
Apple-Dienste für Millionen Privatnutzer. Netflix-Lizenzen, Salesforce-Software, Amazon-Serverdienste.
All das sind hochwertige, kostenpflichtige, wirtschaftlich zentrale Dienstleistungen, die nicht auf Schiffen, sondern in Datenpaketen die Grenze überqueren.
Und sie sind es, die den wahren Importüberschuss der Schweiz ausmachen, nur dass sie nicht als solcher verbucht werden.
Denn die Zahlungsflüsse dieser Dienstleistungen, zum Beispiel für eine Google-Werbekampagne, gehen nicht an Google USA, sondern an Google Ireland Ltd.
Die Buchung erscheint als „innergemeinschaftliche sonstige Leistung“, nicht als amerikanischer Export. Das Produkt kommt aus den USA, die Rechnung aus Irland.
Das Ergebnis: Ein gigantischer, unsichtbarer US-Export, der offiziell nicht existiert.
Die Summe dieser „Geisterimporte“ ist enorm und wächst jedes Jahr.
Nach aktuellen, konservativen Schätzungen fliessen jährlich mindestens 5 Milliarden Franken von Schweizer Konsumenten und Unternehmen an nur sieben grosse US-Plattform-Unternehmen:
Google, Microsoft, Apple, Amazon Web Services, Meta, Netflix und Salesforce.
Diese Zahl umfasst: Werbung auf YouTube, Facebook, Instagram; Cloud- und Speicherlösungen von AWS, Azure, iCloud; Software-Lizenzen von Microsoft, Adobe, Salesforce.
Dann: Streaming-Dienste von Netflix, Apple, Amazon; App-Käufe, In-App-Werbung, Lizenzmodelle; automatisierte Zahlungssysteme, Schnittstellenzugriffe, Analytik-Dienste.
Kurz: Die komplette digitale Infrastruktur des Landes wird zu einem grossen Teil aus dem Ausland bezogen, ohne dass dies in der Aussenhandelsstatistik korrekt abgebildet wird.
Die Folgen sind fatal: Die Schweiz erscheint auf dem Papier als Exportweltmeister, dabei importiert sie in Wahrheit digitale Hochtechnologie in Milliardenhöhe.
Nur eben nicht in Containern, sondern über Datenverbindungen.
Und das Finanzsystem, das diese Realität messen sollte, versagt dabei vollständig.
Diese Situation führt zu einer wirtschaftspolitischen Doppel-Illusion: Die USA glauben, sie seien im Nachteil, weil sie den Warenverkehr sehen, aber nicht den Dienstleistungsgewinn.
Die Schweiz glaubt, sie sei in Kontrolle, weil sie Steuereinnahmen aus realwirtschaftlicher Produktion erzielt.
Aber nicht erkennt, wie viele Milliarden an Wertschöpfung das Land jährlich verlassen, ohne kontrolliert, besteuert oder reguliert zu werden.
So entsteht ein scheinbarer Schweizer Exportüberschuss, der in Wahrheit ein digitaler Importdefizit-Schleier ist.
Und während Politiker in Washington Sanktionen fordern, versäumen es Schweizer Entscheidungsträger, auf die wahre Handelslage hinzuweisen oder sie überhaupt zu erkennen.
Dabei sind die offiziellen Zahlen bekannt: 2023 exportierte die Schweiz Waren im Wert von rund 53 Milliarden Franken in die USA, importierte aber nur Produkte im Wert von 14 Milliarden.
Der Überschuss beträgt beachtliche 39 Milliarden Franken, was die USA zum wichtigsten Exportmarkt der Schweiz macht.
Doch der Dienstleistungsbereich erzählt eine andere Geschichte: Die Schweiz exportierte 28 Milliarden Franken an Dienstleistungen, importierte jedoch 49 Milliarden Franken aus den USA.
Ergebnis: Ein Schweizer Defizit von 21 Milliarden Franken im Dienstleistungsverkehr.
Das Defizit aus Sicht der USA schmilz um mehr als die Hälfte auf noch 18 Milliarden.
Ein Defizit, das auf amerikanischer Seite, aus politischem Kalkül oder bewusstem Wegsehen ignoriert wird. Und ein Defizit, das den angeblichen „Warenüberschuss“ der Schweiz mehr als kompensiert.
Hinzu kommt: Schweizer Unternehmen investieren massiv in die USA.
Der Kapitalbestand beläuft sich laut Seco auf 288 Milliarden Franken. Nirgendwo sonst investiert die Schweiz mehr.
Rund 340’000 Arbeitsplätze in den USA werden dadurch finanziert, ein wirtschaftlicher Beitrag, der kaum in Trumps Zoll-Rhetorik vorkommt.
Und auch die Währungsfrage war bereits Thema: 2020 warf das US-Finanzministerium der Schweiz „Devisenmanipulation“ vor, ein Vorwurf, der nach dem Machtwechsel zu Joe Biden wieder fallen gelassen wurde.
Doch der politische Reflex blieb: Die Schweiz wird als cleverer Taktierer wahrgenommen, als ein Land, das vom System profitiert, ohne genug zurückzugeben.
Ein Irrtum, der nur bestehen bleiben kann, weil digitale Leistungen keine physischen Spuren hinterlassen.
Ein weiteres Missverständnis liegt im Vergleichswert. Der Export von Käse oder Uhren erzeugt zwar Umsatz, aber auch immense Produktionskosten.
In einem Kilo Käse stecken Kühe, Futter, Transport, Verarbeitung, Verpackung, Logistik. Viel Umsatz, wenig Gewinn.
Dem steht ein digitaler Dienstleistungsverkauf gegenüber, der gigantisch ist. Beispielsweise ein Werbeclip auf YouTube, eingeblendet vor einem Video, das ein Schweizer Nutzer selbst produziert und YouTube gratis zur Verfügung stellt.
Google muss dafür nichts zusätzlich herstellen. Der Clip wird millionenfach ausgespielt und bringt Google reinen Gewinn.
Ohne Lagerhaltung, ohne Lieferketten, ohne Personal. Es ist der Inbegriff skalierbarer Wertschöpfung – und der Albtraum jeder gerechten Bilanzierung.
Die Schweiz befindet sich in einem Zustand wirtschaftlicher Transparenz, jedoch nur dort, wo es um klassische Waren geht.
Im digitalen Bereich herrscht statistischer Nebel, durch den jährlich Milliarden verschwinden, ohne dass sie je die Aufmerksamkeit von Bundesämtern, Politik oder Öffentlichkeit auf sich ziehen.
Und während in Washington auf Grundlage veralteter Zahlen Zollschranken errichtet werden, bleibt die Schweiz wirtschaftlich verwundbar, finanziell ausblutend und politisch passiv.
Sie verteidigt ihre Neutralität mit militärischer Präzision, aber ihre digitale Realität ist vollständig offen.
Wer das versteht, versteht auch: Die Frage ist nicht, ob die Schweiz ein Handelsdefizit mit den USA hat. Die Frage ist, warum sie sich nicht eingesteht, dass es das falsche Defizit ist.
Kommentare
Kommentieren
Die beliebtesten Kommentare
-
Des Pudels Kern liegt anderswo begraben: Washington unterzeichnet mit vielen Ländern Freihandelsabkommen, die sich gar nicht daran halten wollen. Beispielsweise behauptet(e) Japan, dass japanischer Schnee anders sei als Schnee in den USA, und amerikanische Skis deshalb in Japan lebensgefährlich wären und entsprechend verbot.
Bei solchen Länder ist es absolut sinnvoll, Importe und Exporte gegeneinander abzuwägen, Betrug zu vermuten, und Zölle als Verhandlungmasse in die Waagschale zu werfen.
Die Schweiz exportiert enorm viel Gold, bei der die Wertschöpfung minim ist, in die USA. Trumps Leute im Weissen Haus vertrauen der vorwiegend stark anti-Trump US-Verwaltung sehr wenig, und führen die Verhandlungen selbst. Bei 192 Ländern sind sie schon durch die Anzahl Dossiers sehr stark gefordert, und gingen nicht auf die Einzelheiten eines jeden Landes ein. Bei den Verhandlungen wird das geschehen.
Das kommt schon gut!
-
Die USA hatte bis vorletzter Woche kaum Zölle erhoben. Daher sind für sie die ‚nicht verzollten‘ Digital-Services in der Schweiz kein Thema! Lediglich der physische Güterverkehr weist teilweise erhebliche Unterschiede bei den Zoll-/MWST-Belastungen auf! Ich als Konsument ziehe Zölle der MWST vor (wenn ich wählen müsste). Was sind wohl die Gründe? M.E. sind Zölle ‚konsumentenfreundlicher‘ als die MWST!
-
Stimmt schon. Aber ob das die Verantwortlichen in Bern kümmert? Wohl zu abstrakt für unsere Beamten, die wollen dann auch mal nach Hause.
-
Trump ist ein dreister Lügner. Entgegen seiner Behauptung erhebt die Schweiz keine 62 % Zölle auf US-Produkte, sondern die Zahl ist das Warenhandelsdefizit der USA gegenüber der CH – ein Defizit, das in erster Linie durch die hohe Qualität schweizerischer Güter entsteht. Es handelt sich also nicht um eine Benachteiligung der USA, sondern vielmehr um die Leistungsstärke der CH Wirtschaft.
Zudem verzeichnen die USA im Dienstleistungsbereich (Google, Facebook, Netflix) einen deutlichen Überschuss gegenüber der CH. Berücksichtigt man diesen Faktor, wäre die Gesamtbilanz zwischen den beiden Ländern nahezu ausgeglichen. Auf Dienstleistungen erhebt die CH keine Zölle.
Trump blendet systematisch die Bereiche aus, in denen die USA profitieren, und stellt falsche Behauptungen über „unfaire“ Praktiken auf. Gleichzeitig verschweigt er, dass es genügend Beispiele gibt, in denen die USA anderen Nationen überlegen sind, ohne dafür durch Zölle eingeschränkt zu werden.
-
Danke für diesen Artikel, für den ich sehr dankbar bin. Unser Berner Staatsapparat ist einfältig, faul und nicht sehr intelligent, um es vornehm auszudrücken. Unsere Statistiker liefern keine Argumente, sie tun nur das, was man immer schon tat. Etwas Trump würde uns schon gut tun und wir sollten die Schweiz auch als Firma, Gesellschaft sehen. Oder Milei könnte auch einige Impulse geben. Aber statt dessen schläft man, fühlt sich behaglich im überbezahlten 35-Stunden Job.
-
-
Der Autor rennt offene Türen ein. Bern versteht sehr gut-und sagt dies laufend-dass das Dienstleistungsdefizit den schweizerischen Exportüberschuss kompensiert. Problem ist : Trump ist dies egal; genau wie er ‚reziproke Tarife‘ erfindet, die es so nicht gibt..Gegen ( gewollte) Dummheit kämpfen selbst Götter vergebens
-
Wer aus der Bevölkerung hat soviel Unterstützung von den Eigentümern der Degussa wie Er?
Kaum jemand der abhängig Beschäftigten den die werden durch Liberalismus (und dessen Varianten) völlig legal für dumm verkauft und betrogen. Wärend des Lebens droht psychische Krankheit, Invalidität, Krankheit, Armut. Ohne den von Krall verhassten Staat würden die krank geschufteten und von Versicherungen betrogenen (Gutachten, IV, Justiz) Leute gar ohne soziale, medizinische Absicherung durch frühen Tod erledigt… wer das sagt? Das BSV erfasst viele dieser Daten und publiziert diese auch. Justitia besitzt heute als effizientes Werkzeug das mächtigste Schwert. -
Da gibt’s nur ein Weg, Netflix-, Disney-und Co.-Abo’s künden, von Windows auf Linux umsteigen, etc., weil die USA halten sich als Imperialist nie an die Regeln, die sie für die Welt aufstellen und endlich der Illusion aufgeben, dass die USA ein freundlich gesinnt Staat ist, denn die USA hat weder Freunde noch Feinde, sondern immer nur eigene Interessen.
-
Iphone hat einen Marktanteil von über 49% in der Schweiz. Das sind offiziell keine USA Importe, aber Apple setzt damit Milliarden um in der Schweiz.
-
Nicht vergessen sollte man die riesige Menge an Hardware, also Computer, Notebooks, Pads, Kopfhörer, Telefone, Grafikkarten, Prozessoren usw. von Microsoft, Nvidia, Apple, Intel sowie weiteren US-Herstellern. Dass die meisten davon nicht in Amerika, sondern im asiatischen Raum hergestellt werden, ist nicht unsere Wahl oder gar unser Wunsch. Fakt ist auch, dass die grossen Gewinne daraus aber direkt oder sicher indirekt in die USA fliessen.
Diese Umsätze sind viele Milliarden, welche auch zur Handelsbilanz zählen sollten. Und zwar nicht mit China, Taiwan oder anderen Ländern, sondern den USA.
-
In dieser Kommentarspalte tummelt sich geballte Kompetenz in Wirtschaftswissenschaften. Alles kleine Sanggaller, könnte man meinen.
-
@ Ökolonom Mörgeli
Genau, der Weltwoche fehlt ein unabhängiger Ökonom, der diesen Namen verdient.
Leider ist die Wirtschaftskompetenz in der WW gegenüber der NZZ auf einem tiefen Niveau.
-
-
Der nackte Beweis, wie mit manipulierten Statistiken und falschen Zahlen die Bevölkerung desinformiert und manipuliert werden kann. Sowas nennt sich Politik. Statt den Halbwahrheiten zu glauben, lob ich mir den Abakus.
-
Die Dienstleistungsbilanz der Schweiz mit den USA ist negativ. Und was Trump vor allem ausklammert, ist, dass der US Dollar weltweit Reservewährung ist. Die FED kann auf Knopfdruck beliebig viele Milliarden Dollars aus dem Nichts drucken, um damit nicht nur Industriegüter und andere Waren aller Art auf der ganzen Welt gratis einkaufen, sondern auch das US amerikanische Budgetdefizit finanzieren und andere Länder zwingen, US Staatsanleihen zu zeichnen, damit sie Waren in die USA gegen Fiatgeld verkaufen dürfen. Die Chinesen können davon ein Liedchen singen.
-
Genau – die können nicht rechnen in Bern!
-
Spot on.
-
“Google muss dafür nichts zusätzlich herstellen. Der Clip wird millionenfach ausgespielt und bringt Google reinen Gewinn”.
Geehrter Prpić, sie übersehen geflissentlich dass Google 3-stelligen Milliarden Summen über mehrere Jahrzehnten investiert hat um heute sich in dieser Stellung zu bringen. Desgleichen Microsoft, desgleichen Amazon, desgleichen Apple, usw.usw. (Btw,…Ersten Semester BWL…) Merken auch dass diese Auflistung keine entsprechende Europäische Konkurrenten beinhaltet. Jahrzehnten lange Innovations- und Investitionsfeindliche Europäische Politik (Überbordende Steuer-, Energie- und Regulatorische Politik, etc.) haben zu diese Misere geführt, sodass wir heute in der Digitalenwelt Amerika völlig ausgeliefert sind. Digitale Steuer??? Good luck!-
Die Schweiz hat über Jahrzehnte vierstellige Milliarden investiert: Bildung, Forschung, Infrastruktur, globale Stabilität.
Das Web wurde am CERN in Genf erfunden, finanziert vom Schweizer Steuerzahler und der Welt kostenlos zur Verfügung gestellt.
Heute laufen Milliarden-Gewinne über diese Erfindung, aber nicht zurück in die Schweiz.
Schweizer Netze, Strom, Rechenzentren, Kaufkraft, die Grundlage für digitale US-Gewinne.
Die Schweiz trägt die Kosten, die USA kassieren den Gewinn und vergessen gern, wo’s herkommt.
-
Ach, hören Sie doch auf mit dem Gejammer. Viele Ihrer genannten CH Dienstleistungen wurden nur erbracht, indem die Steuerzahler übergangen wurden. Gutmenschtum in seiner reinsten Form, ohne dass jemand danach fragte, und immer in der Hoffnung, dass die Schweiz im Ausland endlich wieder einmal irgendwo wahrgenommen würde. Im Innern fällt das Land stetig in ein Präkariat ab; die Infrastruktur ist total am Anschlag, die Wohnsituation seit Jahrzehnten untragbar, das Gesundheitswesen ist eingeknickt, und die innere Sicherheit wird nur noch durch ausgedehnte Administrierung und Kontrolle aufrechterhalten. Es wird von unberührter Natur gefaselt, während allein das Picknick am Waldrand oder am See in der Realität aber entweder gebührenpflichtig, verboten oder Teil eines Massenauflaufs ist. Ihre Innovation mag gut für’s Selbstbewusstsein sein, den hunderttausenden systemisch und systematisch eliminierten Arbeitnehmern ab 50 nützt die Beweihräucherung aber nichts.
-
Tja, @Sam, hast du halt auf‘s falsche Pferd gesetzt. Aber das ist eben, wenn man immer wieder rechte Schlechtmenschen wählt.
-
-
Sehr guter Beitrag, gegen den Schluss fehlt mir ein bisschen die Würze.
Weiter so, danke.
-
Genau so ist es. Ein riessiger US-Staubsauger für Streaminggebühren, Lizenzgebühren, Transaktionsgebühren, you name it – für Firmen und Private, da kommen sicher ein paar Milliarden zusammen.
-
Der Albtraum jeder gerechten Bilanzierung ist, Kosten zu externalisieren.
-
Viele meinen, Donal Trump ist intelligent weil er reich ist. Er ist aber nur reich und dazu rücksichtslos.
Durch seinen narzisstischen Character umgibt er sich auch nur noch mit Ja-Sagern. Sein beschränkter Intellekt reichte für die Privatwirtschaft.
In der Politik führt er seine Landsleute aber direkt in ein schlechteres Leben und merkt es nicht mal.
-
Viele meinen auch, der Stable Genius habe sich sein Vermögen von Grund auf selber erarbeitet. Sein Vater war aber bereits als Immobilienmakler in New York erfolgreich und hatte ein nicht unerhebliches Vermögen angehäuft. Der „Dealmaker“ ist also mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen.
-
In Kanada läuft schon längst die Diskussion, dass man den Unfug vom Digital Millennium Copyright Act wieder fallen lässt. Denn den haben die USA damals den anderen aufgedrängt mit dem Versprechen geringer Zölle.
Wir haben in der Schweiz (und vielen anderen europäischen Ländern) ein absolut absurdes Urheberrecht, die nur den grossen Konzernen hilft, während es Kreativität und Innovation erstickt. Wir zahlen Abgaben auf Leermedien und Abspielgeräte, dürfen aber keine Werke mehr für Freunde und Verwandte kopieren oder ausleihen.
Früher war es völlig normal, aus Funk und Fernsehen Werke aufzunehmen für die private Sammlung. Heute kommt man schon ins Gefängnis, wenn man Kopierschutz «umgeht».
-

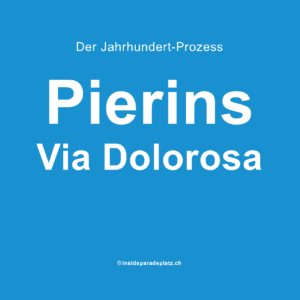

Genau so ist es. Ein riessiger US-Staubsauger für Streaminggebühren, Lizenzgebühren, Transaktionsgebühren, you name it - für Firmen und Private, da…
Sehr guter Beitrag, gegen den Schluss fehlt mir ein bisschen die Würze. Weiter so, danke.
Viele meinen, Donal Trump ist intelligent weil er reich ist. Er ist aber nur reich und dazu rücksichtslos. Durch seinen…