Seit Ausbruch der Finanzmarktkrise im Jahr 2007 war die Bilanz der UBS nie mehr so sicher wie per Ende letzten Jahres. Die risikogewichteten Aktiven im Verhältnis zum Total der bilanzierten Aktiven lagen noch bei knapp 14 Prozent. Im Durchschnitt galten demnach über 85 Prozent der nach den üblichen Kreditausfallrisiken bewerteten Bilanzaktiven als sicher. Bei der Credit Suisse waren es immerhin noch deutlich über 75 Prozent. Beide Grossbanken zählten ausserdem gemessen an den Eigenmittelkennzahlen auf risikogewichteter Basis im internationalen Vergleich zu den bestkapitalisierten Banken.
Vor allem der UBS ist zu attestieren, dass sie ihre Bilanzrisiken durch „mitigation efforts“ im Nachgang zu den Verwerfungen von 2008 deutlich reduzieren konnte. Allerdings ist gleichzeitig zu bemerken, dass die risikogewichteten Aktiven oder „risk weighted assets“ (RWA) ein trügerisches Bild der tatsächlichen Bilanzrisiken vermitteln. Denn obschon die Bilanzen der beiden Schweizer Grossbanken seit 2007 stark verkürzt wurden – bei der UBS um mehr als einen Drittel, bei der CS um mehr als einen Fünftel – und gleichzeitig das den Aktionären anrechenbare Eigenkapital gestiegen ist – im Fall der UBS um mehr als 50 Prozent, im Fall der CS um knapp 6 Prozent –, ist die ungewichtete Eigenmittelquote noch längst nicht im Bereich der von der Too-Big-To-Fail-Regelung implizit anvisierten 5 Prozent; jene der UBS liegt erst bei knapp 4 und jene der CS bei leicht über 3 Prozent.
Die beiden Grossbanken haben zur Erreichung der neuen gesetzlichen Eigenmittelausstattung zwar noch bis 2018 Zeit, angesichts der sich im europäischen Ausland in den Bankbilanzen türmenden Risiken wäre jedoch ein früheres Erreichen der gesetzlichen Minima mehr als nur erwünscht. Mehr Kapital würde zudem die geplanten makroprudentiellen Massnahmen hinfällig machen. Die Diskussion um einen antizyklischen Kapitalpuffer sowie maximale Belehnungs- und Tragbarkeitsgrenzen könnte man sich nämlich sparen, wenn die Grossbanken mehr eigene Mittel halten müssten. Allerdings würde das deutlich mehr eigenes Kapital voraussetzen als nur die gesetzlich implizit angepeilten 5 Prozent auf ungewichteter Basis. Professor Martin Hellwig vom Max Planck Institut spricht beispielsweise von deutlich über 15 Prozent eigene Mittel auf ungewichteter Basis.
Mehr Eigenkapital brächte verschiedene weitere Vorteile mit sich. Erstens könnte damit die gegenseitige Abhängigkeit von Banken und Aufsichtsbehörden verringert werden. Wenn eine Bank beispielsweise 15 Prozent echtes und verlustabsorbierendes Eigenkapital halten würde, könnte sich zum einen die Aufsicht die Prüfung der bankinternen Risikomodelle sparen. Im Gegenzug würde das für die Banken selbst einen Zugewinn an unternehmerischer Freiheit bedeuten, da die Aufsicht nicht mehr bei jeder Entscheidung dem Management über die Schulter schauen müsste. Von Banken mit mehr eigenen Mitteln gingen ferner geringere systemische Risiken aus, was gerade im Zusammenhang mit der makroprudentiellen Regulierung von Bedeutung ist. Qua Definition läuft das makroprudentielle Instrumentarium auf ein Mikro-Management der Kapital-Allokation in einer Volkswirtschaft hinaus, was verschiedene volkswirtschaftlich unerwünschte Verzerrungen mit sich bringt, die später wiederum weitere Regulierungen nach sich ziehen. Insgesamt wäre natürlich mehr Eigenkapital aus volkswirtschaftlicher Sicht begrüssenswert. Und vorausgesetzt, die Risiken werden richtig eingepreist, ergäbe sich auch aus betriebswirtschaftlicher kein Zielkonflikt dazu.
Grundsätzlich kommen zunehmend Zweifel auf an der Logik der Risikogewichtung der Bilanzaktiven, wie sie dem Basler Regelwerk zu Grunde liegt. Denn die Risikogewichtung und die damit verbundenen Bilanzkennzahlen suggerieren eine Sicherheit, die so nicht existiert. Gerade die Krise in der Eurozone zeigt die Grenzen des Risikomanagements täglich von Neuem auf. Am Anfang der Finanzmarktkrise passierte bekanntlich folgendes: Anleihen, die ex ante ein geringes Kreditrisiko aufwiesen, erhielten ein Triple-A-Rating und mussten nur zu einem Bruchteil des normalen Eigenkapitals unterlegt werden. Die Banken hatten somit starke Anreize, ihre Bilanzen mit vermeintlich „sicheren“ Papieren zu füllen, dies umso mehr noch, als sie deutlich besser rentierten als Staatsanleihen. Als sich diese Wertschriften aber plötzlich als Schrott entpuppten, fielen die Ratings, und die Finanzinstitute mussten auf einmal für diese Papiere mehr Eigenkapital vorhalten. Grosse Löcher in den Bilanzen waren die Folge.
Die Risikogewichtung führte in der Krise prozyklisch zu erheblich steigendem Eigenkapitalbedarf, weil sich die Kreditqualität allgemein verschlechterte. Der Unterschied der aktuellen Eurokrise zum Beginn der Finanzmarktkrise liegt nun darin, dass anstatt der damaligen Subprime-Papiere heute Staatsanleihen als sichere Anlagen gehandelt werden. Konsequenterweise haben die grossen europäischen Banken ihre Bilanzen bis unters Dach mit solchen Aktiven gefüllt. Ein Schuldenschnitt zugunsten eines Eurolandes würde sich folglich verheerend auf die Bankbilanzen auswirken.
Die Stossrichtung der Regulierung sollte demnach weniger auf Massnahmen bezüglich des Risikomanagements fokussieren und dafür vielmehr auf die Solvenz der Banken und die Stabilität des Bankensystems abzielen. Dies kann vor allem durch eine substantielle Erhöhung der Eigenmittelquote an der ungewichteten Bilanzsumme erreicht werden. Die sich laufend verschärfende Krise in der Eurozone konnte bislang mit Instrumenten, die auf der Logik des Basler Regelwerkes aufbauen, nicht entschärft und schon gar nicht verhindert werden. Weshalb sollten daher mehr solche Instrumente Besserung bringen? Besserung kann letztlich nur kommen, wenn Banken deutlich mehr eigene Mittel halten müssen – auch in der Schweiz. Denn weiterhin sind die beiden Grossbanken drastisch unterkapitalisiert.
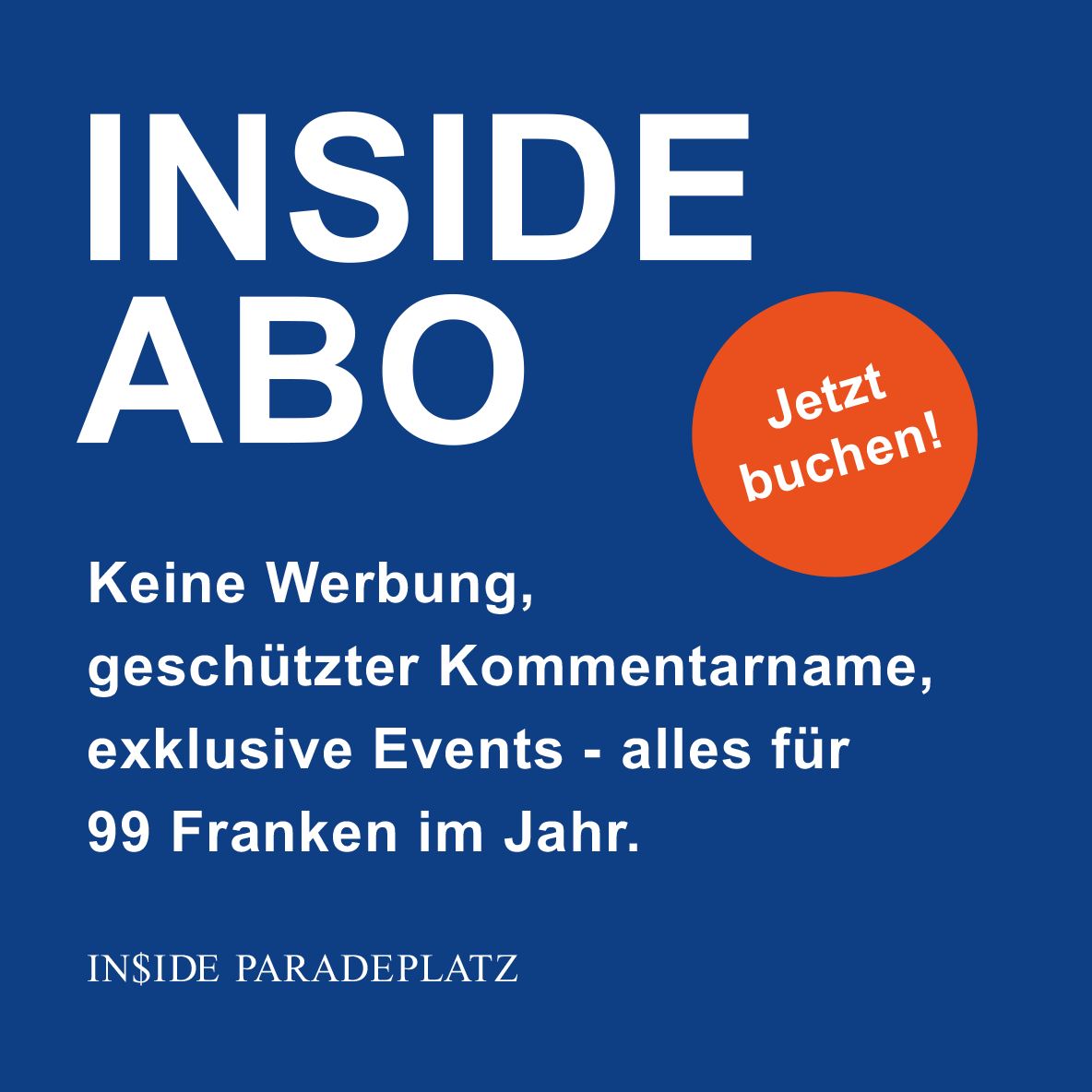

Interessanterweise wenden amerikanische Banken viel weniger die Basel-Regelwerke an. Diese Banken halten Core-Capital to Total Asset Ratios von ca. 6-9%, wogegen europäische Banken im Bereich von 3-5% liegen (Quelle Barclays). Das Problem des Risk Weighted Ansatz (RWA) liegt meines Erachtens darin, dass Banken ihre eigenen Berechnungen dazu anstellen können (Internal Rating Based Approach, IRB). Logischerweise ist der Bias zu Gunsten der Bank und in der nächsten Krise kommt das grosse Staunen. Basel III tendiert dazu IRB’s abzuschaffen und ein standartisiertes, vorgegebenes RWA-Modell zu wählen. Somit würde immerhin etwas mehr Vergleichbarkeit zwischen Banken aufkommen. Contingent Convertibles (CoCo’s) sind m.E. ein sehr gutes Instrument für ein vorgegebenes RWA-Model. CoCo’s weisen ab gewissen Verlusten auf der Aktivseite der Bilanz eine negative Korrelation zur Capital Ratio auf (diese geht dann hoch oder stabilisiert sich). Durch das Vermischen von Kommerz- und Investmentbanking ist es aber auch in Zukunft fast nicht möglich, so komplexe Bilanzen auf einen simplen Nenner zu bringen. Aus der Vergangenheit zu schliessen (über Daumen gepeilt) würde aber eine minimale Core-Capital to Total Asset Ratio von 5% in Kombination mit einer standartisierten RWA Model Ratio von 10-15% schon recht sichere Banken machen. Weiter muss transparenz geschaffen werden. Diese (standartisierten, vergleichbaren) Ratios müssen quartalsweise publiziert werden (zBsp auch auf dem Kontoauszug o.ä.). Natürlich muss der Kunde halt auch wachsam sein, wo er sein Spargeld deponiert. Weniger, nicht mehr Einlegerschutz fördert die Wachsamkeit und somit wo die Spareinlagen hinfliessen. Bankmanager werden dadurch gezwungen sein, für Einlagen (und somit billigem Geld) mit einer sicheren Bank zu werben. Hoher Leverage und exorbitante Salärbezüge würden so bestimmt viel mehr von Kunden abgestraft als noch früher.