Die Vermögensverwaltung würde die Investmentbank benötigen, wiederholte die UBS-Spitze ihr Mantra am kürzlichen Investorentag. Das Argument besteht aus zwei Behauptungen: Erstens, dass die Superreichen dieser Welt massgeschneiderte Produkte und Finanzdienstleistungen wollen, die weit über das hinausgehen, was einfache Privatbanken offerieren können; und zweitens, dass ein solcher Service nur offeriert werden kann, wenn unter demselben Dach die Privatbank mit einer Investmentbank verbunden ist.
Ist dies in der Tat so?
Bevor wir uns dem Geschäft mit den Superreichen (definiert als solche mit mehr als 50 Millionen Finanzkapital) zuwenden, fassen wir kurz zusammen, warum es grundsätzlich eine schlechte Idee ist, Investmentbanking und Privatbanking innerhalb einer Organisation zu betreiben.
Zwischen Investmentbanking und Privatbanking gibt es enorme Interessenkonflikte. Investmentbanker betrachten ihre Kunden als Gegenparteien, als hoch professionelle Spezialisten also. Wie bei einem Schachspiel ist es erbauend, wenn man mit einer besonders cleveren Strategie den Gegner matt setzen kann. Was im internen Ansehen der Investmentbank zählt, sind Gewinn und Verlust – oft auf Tagesbasis.
Natürlich sind auch die Kunden wichtig, aber eben nur solange sie laufend viel zahlen. Im Kern ist Investmentbanking heute ein Verkaufs- und Handelsgeschäft. Das klassische „Corporate Finance“, also das Beratungsgeschäft für Firmen, macht nur noch ein kleiner Bruchteil der Einnahmen aus. Selber auf einen Fall von Immobilienpreise zu spekulieren, während man gleichzeitig noch ein paar Gegenparteien locker in die Immobilienblase „reinschwatzt“, wie dies Goldman Sachs gemacht hat, ist in diesem Geschäft nur dann bedauerlich, wenn es publik wird.
Die Privatkunden hingegen sehen ihren Berater als Vertrauten, der ihnen unberirrt von eigennützigen Versuchungen helfen soll, eine langfristig berechenbare Performance zu erzielen. Insbesondere soll der Berater sie objektiv über die Produkte und Dienstleistungen informieren und beraten und nicht einfach verkaufen, was für die Bank kurzfristig am lukrativsten ist. Die Befürchtung ist nun, dass beim Modell der „One bank“ das langfristige Interesse des Privatkunden hinter dem kurzfristigen Interesse der Investmentbank zurücksteht, der Interessenskonflikt zugunsten der Investmentbank gelöst wird. Diesen Konflikt tagtäglich zu managen, ist alles andere als einfach. Eigentlich ist dies fast unmöglich.
Es bestreitet aber niemand, dass es auch Synergien im „One Bank“-Modell gibt. Über das Ausmass gibt es jedoch verschiedene Meinungen. Die internen Reibereien zwischen den unterschiedlichen Kulturen und die mit der enormen Komplexität verbundenen Kosten und Schwierigkeiten, eine solche Bank zu führen, werden meines Erachtens kaum durch die Synergien im technischen Bereich wie IT aufgewogen. Zudem: Eine Investmentbank am Rande der Insolvenz zerstört mit einem Schlag, was Privatbanker über Jahrzehnte an Kundenvertrauen aufgebaut haben.
Investmentbanking war schon immer ein fantastisches Geschäft für die Manager und die Angestellten. Aus der Sicht des Aktionärs oder Regulators sieht es leider anders aus. Das „One Bank“-Modell kommt bei den Eigentümern schon lange nicht mehr gut an; die Verluste in der Finanzkrise waren einmal mehr augenöffnend. Man hätte wohl lieber zwei separate Aktiengesellschaften, vor allem die Möglichkeit, nur bei der Pirvatbank investiert zu sein.
Der Aktionär ist auch das Jammern der Investmentbanker müde, das da heisst: Schlechte Performance erfordert hohe Boni, damit jemand bleibt, gute Performance dito. Und für die Regulatoren respektive die Regierungen, die notfalls zur Rettung einspringen müssen, bleibt das „One bank“-Modell eine Option mit ausschliesslich „Down side“-Potenzial. Die Schuldenrestrukturierungen in Griechenland und vielleicht weiteren Euro-Ländern hilft uns, unsere Erinnerungen an diese Tatsache aufzufrischen.
Kann das Gegenargument mit den Superreichen wirklich das „One bank“-Modell retten?
Es gibt doch Investmentfirmen, die hervorragende Produkte und Finanzdienstleitungen an Superreiche anbieten ohne eine Investmentbank zu haben. Bill Gross’s PIMCO (einer der grössten und besten Fixed Income Fundmanager der Welt) hat noch nie nie damit argumentiert, er brauche eine Investmentbank. 300 PIMCO-Profis sind in der Lage, für Supperreiche so ziemlich alles anzubieten, was man auf der Fixed-Income-Palette als Anleger braucht. Auch die Hedgefund-Industrie floriert gut, ohne dass dort versucht würde, Investmentbanken aufzubauen. Die UBS-Privatbank könnte somit bestimmt einiges an komplexen Dienstleistungen anbieten, auch ohne grosse, eigene Investmentbank.
Natürlich wäre das nicht ganz einfach. In der Tat offerieren Investmentbanken wie die UBS Dienstleistungen an Fundmanager, die teilweise auch von den Superreichen nachgefragt werden. Dazu gehören automatisierte Ausführungen von globalen Börsenaufträgen, die Belehnung von Wertschriften, ein Market Making in Over-the-counter-Produkten wie Devisen, Edelmetallen, Derivaten und vielem Anderen. Sophistizierte Vermögensverwalter und Privatbanker wollen diesen Service für ihre superreichen Kunden. Die UBS Privatbank müsste deshalb einige dieser Geschäftsfelder selber aufbauen (beispielsweise einen globalen Service zur Ausführung von Börsenaufträgen, Desks für strukturierte Produkte etc.) beziehungsweise dieses Angebot in enger Kooperation mit einer oder mehreren externen Investmentbanken als Leistungserbringer entsprechend ausbauen.
Welche Geschäfte mit den Superreichen würden trotzdem verloren gehen?
Sicher würde der Privatbank der Zugang zu Unternehmern erschwert, die ihr Geschäft über die UBS Investmentbank verkaufen oder einen Börsengang wagen. Der direkte Zufluss von Neugeld aus solchen Transaktionen würde leiden. Aber ich bezweifle, dass dies längerfristig ein gewichtiges Problem schafft. Wenn Unternehmer ihre Firma verkauft haben und ein paar Jahre das viele Geld haben, suchen sich die besten Vermögensverwalter. Dann spielt es keine Rolle mehr, wer den Börsengang gemacht hatte.
(Der zweite Teil zum Standpunkt von Markus Granziol, warum die UBS ihr Investmentbanking abspalten sollte, erscheint in den nächsten Wochen.)
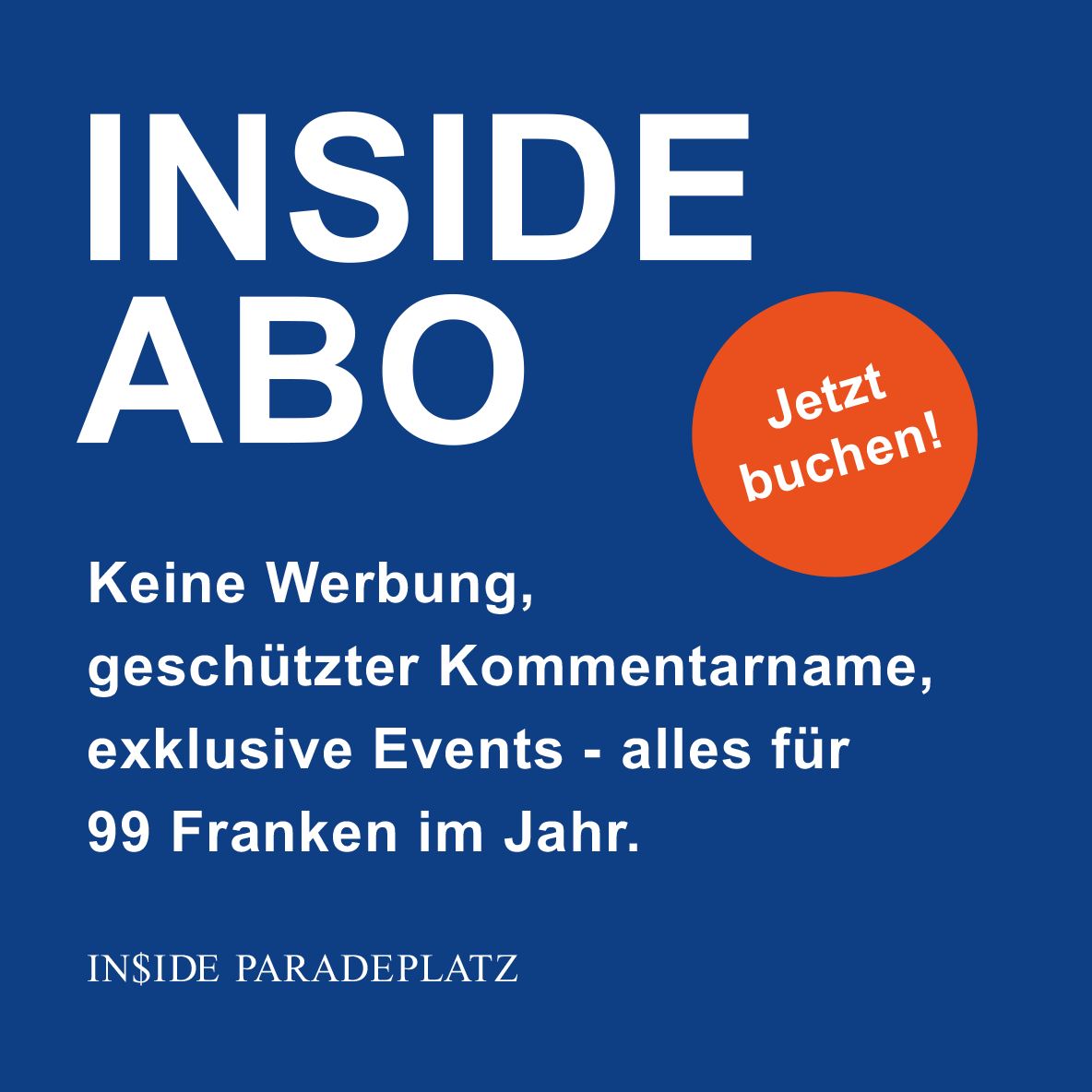

guter artikel, ich erinnere mich gut an die „Sales-offensiven“ der IB. Wenn die IB die Geschäfte der Privatkunden absichert, fresse ich einen Besen.
Nur als Beispiel wären hier die Zinsswaps zu nennen, die man den CH Unternehmen am Laufband andzudrehen versucht, immer begleitet mit dem Hinweis auf die momentan *tiefen“ Zinsen. Ja klar, die Zinsen sinken ja auch seit 30 Jahren!
Ueberall sonst würde man das Betrug nennen. Es wäre ein Fall fürs Gefängnis, im Banking jedoch ein Grund für einen top-league platz in den ranking tables und einen grossen Bonus… GS ist ja offenbar das grosse Vorbild unserer CH Banken! Gods work?