„Wer weniger als 100’000 Franken netto im Jahr verdient, ist arm“, sagt mein Schweizer Anwalt, der nicht nur Scheidungen durchführt. Wenn er aber Scheidungen begleiten muss, rät er den beiden Partnern: „Lasst Euch nur dann scheiden, wenn für jeden 150’000 Franken netto pro Jahr übrig bleiben, um eine Wohnung und auch die Kinder mit deren Ausbildung finanzieren zu können.“
Im Kanton Zug wie auch an der Zürcher Goldküste mehrt sich die Zahl der Ausländer („3rd country nationals“), die ihre Kinder bei den öffentlichen Schulen anmelden. Sie können sich angesichts sinkender Boni die teuren Privatschulen für zwei und mehr Kinder nicht mehr leisten. Gleichzeitig haben sie begriffen, dass auch die staatlichen Schulen in der Schweiz mehr bieten, als dies andernorts in der Welt der Fall ist.
Eine junge Familie mit zwei Kindern braucht in den städtischen Agglomerationen heute auf jeden Fall rund 150’000 Franken im Jahr, um so zu leben, wie man sich ein Leben in der Schweiz vorstellt: hübsche Wohnung oder kleines Haus, ein grösseres und ein kleines Auto, kulturell aktiv, zweimal Ferien im Jahr, dazu modisch-elegante Kleidung, Restaurantbesuche.
Da im Kanton Zürich das Medianeinkommen bei jährlich 60’000 liegt – die Hälfte verdient mehr, die andere Hälfte weniger -, lässt sich leicht erkennen, weshalb auch die meisten Frauen berufstätig sein müssen. Erst zwei Einkommen sichern das angenehme Leben, weshalb Kinder eine enorme Belastung sind; weil die Frau dann als Geld Verdienende ausfällt oder die Kosten für die Kinder die Eltern zum Konsumverzicht zwingen.
Natürlich gibt es grosse bis gewaltige Unterschiede, wie man sein Leben in der Schweiz gestalten kann. Sehr gut gestellt ist man als oberes Kader sämtlicher Verwaltungen und staatsnaher Betriebe, wie Universitäten, Pfarreien oder sozialer Einrichtungen. Als National- und Ständerat erhält man 140’000 bis 170’000 im Jahr, und zwar für einen Halbtagesjob, bei dem man zahlreiche Nebenberufe pflegen kann, sodass die berühmte erste „halbe Kiste“ für den Einstieg in die höheren Ränge bei einigem Talent nicht zu schwer fällt.
Journalisten geht es seit einiger Zeit immer schlechter, weshalb ein höheres Mass an Gereiztheit verständlich ist. Wer, wie beim jungen Online-Magazin „Republik“, ein festes Bruttoeinkommen von 8’000 Franken hat, schläft als Velofahrer in Zürich auf der sicheren Seite. Die Zahl der Grossverdiener in den Medien mit Jahreseinkommen von mindestens 300’000 dürfte auf das „dirty dozen“ geschrumpft sein.
Im Kanton Aargau gelten gemäss einer SP-Initiative Bezüger von Jahreseinkommen unter 100’000 Franken als Geringverdienende, über 100’000 als Gutverdienende, wobei letzteres nur für Singles gilt. Wer eine Familie mit Kindern hat, gilt erst ab 200’000 als Gutverdiener. Reich ist, wer mehr als 320’000 jährlich einnimmt. In Zollikon an der Zürcher Goldküste zahlen fünfhundert Einwohner die Hälfte der Steuern, die anderen zehntausend Steuerpflichtigen den Rest.
Kein Wunder, dass der Druck auf die „seriously rich“ enorm zugenommen hat. Superboni gehören in der Pharmaindustrie und bei den Schweizer Banken längst der Vergangenheit an. „Niemand soll mehr als 10 Millionen Euro verdienen“, sagt auch der Personalvorstand der sich in sehr schlechtem Zustand befindlichen Deutschen Bank in Frankfurt.
Unterhalb dieser Zehn-Millionen-Grenze gibt es in der Schweiz wie andernorts allerdings viel Spielraum. 500 bis 1’000 Mitarbeiter von UBS und CS dürften eine Million Franken im Jahr und mehr verdienen. 35% von total 127 aller in der Schweiz tätigen Radiologen verdienen über 1,5 Millionen bis hin zu fünf Millionen.
Das gilt auch für andere Spitzenärzte, wo Ehrengaben reicher Patienten für deren Stiftungen als Dank für die Genesung nicht eingerechnet sind. Das kann nicht selten ein bis zu zweistelliger Millionenbetrag sein.
Man wird mir entgegen halten, man könne auch mit wenig Geld glücklich sein – und oft sogar mehr als jene Reichen, die in ihren Rolls weinen. Es gehe letztlich um die Würde eines jeden Menschen als Grundlage seiner Freiheit.
Sicher ist dies richtig, denn das Leben in der künstlerischen oder sozialen Bohème war immer eine Attraktion, sei es Hermann Hesse als Nacktkletterer am Walensee, die Menschen auf dem Monte Verità, die Rote Fabrik in Zürich oder die Reithalle in Bern.
Hätten wir im ganzen Land zwischen Zug und Céligny nicht derart viele wohlhabende bis superreiche Ausländer, stünde die Schweiz plötzlich relativ arm da. Unser BIP würde zusammen brechen. Aus der reichen Schweiz würde plötzlich eine Art Oberitalien oder Tirol. Der Kanton Bern könnte nicht mehr mit drei Millionen Franken am Tag subventioniert werden, die Jurassier und die Walliser müssten auf viele Strassen, Schulen und Sozialleistungen verzichten.
Vor 600 Jahren waren Jakob Fugger und Kaspar Jodok Stockalper in Brig mit je einem Prozent des BIP als Privatvermögen viel reicher als einst John D. Rockefeller mit 0,3% oder Jeff Bezos heute mit 0,16% des US-BIP. Die reichen Schweizer mit Christoph Blocher an der Spitze gehören heute zu den armen Milliardären der Welt.
Jetzt geht es um die Wurst (oder das goldene Oster-Ei). Sollen wir wieder ärmer werden, sparsamer leben, energiefreundlicher konsumieren?
Ich denke, ein Viertel aller echten Schweizer wird sich dies vorstellen können. Es weiss noch, was es heisst, in einem Bergdorf im Bündnerland oder im Wallis zu leben. Die Edel-Aussteiger im Tessin leben uns dies bis heute vor.
Ein weiteres Viertel der Schweizer lebt ohnehin in einem eher stagnierenden Zustand. Dort fehlen alle Impulse, sich aus dem relativen Niedergang zu befreien.
Das dritte Viertel hat den Kampf um den wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg noch nicht aufgegeben. Das ist der global wettbewerbsfähigste Teil unserer Bevölkerung.
Das vierte Viertel ist wohlhabend bis sehr reich. Es lebt mit demonstrativem Konsum in der Schweiz oder heimlich an der französischen Riviera – oder irgendwo sonst in der Welt.
Wie kann die Mehrheit der Normalverdiener den Fahrstuhl nach oben wieder in Gang setzen?
Es gibt nur drei Möglichkeiten. Bald erben, gut heiraten oder – die dümmste Lösung: sehr fleissig und sehr talentiert Tag und Nacht selber arbeiten.
Kommentare
Kommentieren
Die beliebtesten Kommentare
-
„…..lässt sich leicht erkennen, weshalb auch die meisten Frauen berufstätig sein müssen……“ dieser ganze Abschnitt ist machistisch und nicht zeitgerecht. Please revise!
-
Einst gab es nur eine Schweiz, die ehrliche Schweiz.
Dann kam der Vater aller Abzocker, Barnevik, CEO und Präsident von ABB. 2001 trat er zurück und schanzte sich
148 Mio als Abfindung zu, obwohl er ABB in schlechter Verfassung zurück liess.
Dann kauften CS und UBS Investmentbanken in den USA mit Ablegern in London. Investmentbanker betrogen Kundenberater und ihre Kunden in der Schweiz. Mit riesigen Boni zockten sie CS und UBS ab.
Statt die Machenschaften zu stoppen und die Bank sauber zu führen, schröpften auch Ospel & Co. die Bank skrupellos.
Die A-Schweiz war geboren und etabliert.-
haben Sie mal überlegt, wer die Order für den Kauf der US-IBs gegeben hat?
haben Sie mal überlegt, dass ohne diese Verknüpfung über den Ozean 2008 auf Europa niemals diese Auswirkungen gehabt hätte?
-
-
Sehr geehrter Herr Stöhlker
Was für ein treffender Artikel, der enorm
viel Aussagekraft hat.Als mausarmer Secondo, der es innert eines halben Arbeitslebens zu Wohlstand gebracht hat, darf ich Ihnen schreiben, dass ich oft nicht mehr verstanden habe, wie die Schweizer Eliten ihr eigenes Land derart kampflos verscherbeln konnten.
Die Aufgabe des Bankkundengeheimnisses, der naive Umgang mit der EU (Ostmilliarden),
die Personenfreizügigkeit, die von irgendwo angeheuerten CEO’s Schweizer Grossunternehmungen, die sich einen Deut um die Schweizer kümmern…alles hat dazu beigetragen, dass wir bald ein neues Tirol sein werden (allerdings ein zubetoniertes) oder es sogar bereits sind.Dieses „Tiroldasein“ schafft eine neue Schicht, die der verarmenden Schweizer – ab 50 jährig -ausgesteuert und ausgeschlossen, ohne jegliches Medianeinkommen. Dazu eine angrenzende Subschicht, die der ab-45 jährigen in restrukturierungsanfälligen Branchen. Diese Leute leben in der ständigen Angst, ihre Anstellung just im „dümmsten“ Moment zu verlieren…und voll in die soziale Abstiegsrutschbahn zu geraten.
Dabei muss man bedenken, dass die nicht oder sehr schwer kürzbaren Lebens-
haltungsfixkosten (Miete, Krankenkasse,
Migros/Denner Esswaren) in der Schweiz unglaublich hoch sind, im Vergleich mit dem europäischen Ausland. Dies schafft Ängste.Wir haben also eine grösser werdende Bevölkerungsschicht, die an Existenzangst leidet (in Japan hat man herausgefunden, dass aus diesen Ängsten Krankheiten entstehen, wie das Tako-Tsubo Syndrom).
Ich glaube, wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren eigenen Mitbürgern.
Wir haben die Pflicht, gegen einen sozialen und wirtschaftlichen Abstieg der Schweiz zu kämpfen. Wir verdanken dem Land viel.
Es ist ein einzigartiges, grossartiges Land.Sie sind ein Kämpfer der guten Sorte, Herr Stöhlker. Ein gemeinsamer, verstorbener Freund (der Kunstmaler Raphael Doria) erzählte mir von Ihnen. Sie sind nicht nur ein Kämpfer der guten Sorte, sondern auch ein herzensguter Menschenfreund, ein Humanist.
Danke Ihnen. Beste Grüsse.
Daniel Martínez
-
Letzter Absatz – Folgerung: Sind Sozialschmarotzer hochintelligent?
-
Natürlich können sie intelligent sein, ganz wie andere Menschen auch. Es geht immer um die Frage, was man mit seiner Intelligenz anfängt.
-
-
Das Durchschnittseinkommen Ende 2016:
– Auf der ganzen Welt: 16’095,10 KKP $
– In Europa: 30’767,77 KKP $
– In Luxenburg: 75’750 KKP $
– In der Schweiz: 63’660 KKP $, knapp vor Norwegen mit 62’510 KKP $.In der Schweiz hat es das erste mal zwischen 2015 und 2016 leicht abgenommen (260 KKP $). In Norwegen geht es seit 2013 deutlich herunter; wesentlich deutlicher als in der Schweiz. 2013 war Norwegen an der Spitze, vor Luxenburg und vor der Schweiz.
Wir sollten aufpassen, dass wir nicht auf hohem Niveau jammern. Andere Einkommen steigen und bei uns ist gerade die Tendenz zur Stagnation. In Anbetracht der Weltlage weiss ich nicht ob uns ein weiterer Anstieg der Einkommen wirklich hilfreich ist oder ob Stagnation auf unserem Einkommenslevel nicht das beste ist, was uns volkswirtschaftlich passieren kann.
Natürlich braucht es kritischen Journalismus, dass es so bleibt. Aber Weltuntergangsstimmung ist noch nicht angebracht.
Was in Norwegen passiert ist, dass es sich vom superreichen Luxusland deutlich in das Mittelfeld hinunter bewegt, das wäre auch mal einen kritischen Artikel wert. Bevor wir dieselben Fehler machen.
-
-
@Statistiker
ich habe es genau nachgerechnet und kam für Europa auf 30’767,76 KKP $ anstatt 30’767,77!
-
Meine Tochter arbeitete 3 Jahre lang in Norwegen von 2009 – 2012. Bezahlung naja, aber Supersozialleistungen. In der Zeit hatten die norwegischen Schulen Mühe, Lehrer zu finden (müssen ja zwangsläufig Norweger sein wegen der Sprache) trotz Salär von CHF 150k. Sie konnten halt nicht mithalten mit den Löhnen in der Ölförderbranche. – Habe dann später mal einen Artikel gelesen, dass es ein grosses Aufatmen bei Schulen und anderen Arbeitgebern gab, als der Ölpreis crashte und sich endlich wieder Mitarbeiter finden liessen. – Übrigens: Credit Suisse ist im Üetlihof nur noch eingemietet. Besitzer ist der norwegische Staatsfonds. Echtes Betongold halt.
-
-
Lieber Herr Stöhlker
Wir kennen uns! – Ich schätze Ihre Beiträge, da sie mir immer wieder einen „Abriss“ über die Wahrnehmung Ihrer Generation in der Schweiz geben und wie die „Denkhaltung“ ist oder sein könnte.
Manchmal muten Ihre Ideen etwas eigenartig an, doch sie zaubern ein Schmunzeln – oder manchmal sogar schallendes Lachen auf meine Lippen, wenn ich mir das Ganze bildhaft vorstelle;-)!
Meine besten Grüsse
Eva Maria Thür-
Liebe Frau Thür,
Ihre Art lebendiger Reaktion auf meine Beobachtungen und Thesen ist ein gutes Beispiel aktiver Wissenserweiterung, manchmal auch nur Gewissensprüfung. Da ich weiss, wie Wissen manipuliert werden kann, bewusst oder unbewusst, verlasse ich mich gerne auf meine eigenen Beobachtungen, die seit immerhin gut sechzig Jahren mit Fleiss erfolgen, notiert und verarbeitet werden. „Eigene Beobachtungen“ heisst bei mir auch, fremdes Wissen aufzunehmen. So empfehle ich den neuen „Lettre International 120“, der sich mit Geopolitik beschäftigt. Wir können alle voneinander lernen.
-
-
Es ist doch immer wieder erstaunlich mit welch proletarischen, großkotzigen Art Stölker abstruse Assoziationen aussondert, generiert aus niederem Intellekt, tiefem IQ und Anerkennungssucht. Eine Stichprobenvarianz seiner geistigen Umnachtung hülfe enorm um Licht in den Hohlkopf zu fluten. [UHNW/BIP, fleißig/talentiert, arbeiten/selber, Vermögen 14J./21Jh., Rich/Einkommen ß/ss etc.]
-
Seid nicht so streng sondern nachsichtig mit Klaus Stöhlker,
in Anbetracht seines fortgeschrittenen Alters! -
„Balduin, der Korinthenkacker“ – war mal der Titel eines Films mit Louis de Funes in der Hauptrolle. Passt sehr gut für einen derart missgelaunten Kommentar wie dem Ihrigen. Gehen Sie mal an die frische Luft und atmen Sie tief durch!
-
-
Bei jedem Kommentar von Klaus J. Stöhlker muss ich herzhaft schmunzeln. Sie sind so belanglos, dümmlich und daneben, dass es eine Freude ist. Sie dienen lediglich seinem über-grossen Ego. Was ich dabei aber schätze: sie lenken ab von den täglichen Herausforderungen. Und erheitern. Hoffe, dass ist auch in seinem Sinn.
-
Liebe Anja Hoffmann, lieber Sam.
Würden Sie sich bitte einmal outen, a) wie alt sie beide sind und b) welche Art von Mensch hinter Ihren Namen oder Symbolen steckt? Gerne diskutiere ich auch mit jüngeren Dummköpfen, lieber aber mit Klügeren. -
Herr Stöhlker,
Weiss nicht, zu was ihnen diese Info dient, aber bitte: so um 40 Jahre im internationalen Handel tätig, auf allen Kontinenten gewohnt (ausser dem 5.), ein Dutzend Mal umgezogen, spreche sechs Sprachen und gehe gegen die 70. Ach ja, bevor ich’s vergesse: bin Abonnent des LI. -
Sam, ich kann mir vorstellen, dass Du in den vielen Auslandjahren den Kontakt zu den Vorgängen in der Schweiz etwas verloren hast. Deine Treue zur „alten Schweiz“, welche ich seit 2008 die B-Schweiz nenne, ehrt Dich. Seit über 20 Jahren hat sich aber, mehr noch als zuvor, die globalisierte A-Schweiz über die B-Schweiz gelegt. Ergebnis: Die A-Schweiz wird laufend stärker, die B-Schweiz immer schwächer. Bundesrat und Parteien dienen im wesentlichen nur noch der Sicherung der Interessen der A-Schweiz, was eine partielle Unterstützung der B-Schweiz nicht ausschliesst. Gottseidank haben wir noch eine grosse Zahl erfolgreicher Firmen, die auch A-Schweiz sind und die man als „echte Schweizer Firma“ bezeichnen kann. Diese Einsichten sind hart, aber korrekt.
-
Herr Stöhlker,
So wird das nichts mit uns beiden. Sie unterstellen mir, den Kontakt mit der Schweiz verloren zu haben. Wie kommen sie zu dieser Meinung? Dachte, dass das Denken in Stereotypen der Vergangenheit angehört.
Danke für die Ehrung meiner Treue zur „alten“ Schweiz. Was soll das nun heissen?
Und bleiben wir doch bitte beim „Sie“ bis wir zusammen die besagten Schweine gehütet haben. Wird wohl nicht geschehen.
A und B Schweiz? Habe ich irgend etwas im Jahr 2008 verpasst was jeder durchschnittlich belesene Mensch nicht mitbekommen hätte und nur die Schweiz betroffen hat?
Wäre interessant zu erfahren, nach welchen Kriterien sie die „echten A-Schweizer Firmen“ definieren. Und, hätten sie eine möglichst aussagekräftige Prognose für die C-Schweiz?
Schönen, sonnigen Abend.
-
-
@Laura Stern alias Samira Courti
Müssen Sie Ihre immer gleiche Ergüsse über Klepto-Ochlokratie wirklich überall posten? In diesem Ausmass über ein Thema zu schreiben, Woche für Woche, in so einem verbitterten Ton gleicht einer Besessenheit. Liebe Samira wenn Sie sich nur in der Opferrolle sehen, ist Zeit etwas in aktiv in Ihrem Leben zu verändern! Indem Sie andere abwerten und für alles anderen die Schuld geben, zeigen Sie, dass Sie ein massives Defizit haben. Vielleicht könnte Ihnen ein guter Therapeut helfen, darüber hinweg zu kommen. Oh nein, Sie verachten ja diese unnütze Schmarotzer. Also weitergifteln, das löst bestimmt Ihre Probleme.
Kleine Kostprobe Ihrer wöchentlicher Perlen, diesmal auf Infosperber:
Es geht allerdings leicht vergessen daß wir ja nicht mehr in einer Demokratie sondern eher in einer Klepto-Ochlokratie leben.
Solange Abzocker und Schmarotzer, die ihre Ergüsse nicht selber finanzieren müssen, ein Stimm- und Wahlrecht haben, wird sich nichts ändern. In so Fern finanziert die SVP und ihre Wählerschaft immerhin deren Ergüsse selber und bevor jetzt jemand mit den Bauern kommt, die machen nicht einmal mehr 5% der SVP Wählerschaft aus!
Die wahren Abzocker und Demokratiefeinde sind, die Kreise die ein vitales Interesse an einer steigenden Staatsquote haben und ein Leben lang auf Kosten der echten NETTO-Steuerzahler leben:
Beamte, Sozial“arbeiter“/-Klienten, Lehrer, Bauern, Polizei, Berufsmilitär, quasi-kommunistisches Gesundheitswesen, Entwicklungs“helfer», Diplomaten, Gutmenschenhetz-Propagandisten der SRG «abzockeridée suisse», Subventions-„Künstler» und wanna-be-„Kulturelle», Studenten etc. manchmal frage ich mich ob in diesem Land überhaupt noch jemand außerhalb der geschützten Werkstatt und völlig unabhängig von Steuergeldern/Zwangsabgaben lebt.
Es wäre ein großer Schritt für eine ECHTE Demokratie wenn nur noch echte Steuerzahler ein Stimm- und Wahlrecht hätten.
-
@Laura Watcher
Auf bachheimer.com schreibt Frau Stern als „Silberlöwin“…
-
@Sternengucker
Auch da schrieb früher eine Silberlöwin. Sie war aber von der klügeren und intelligenteren Sorte.
-
Liebe Laura Watcher
Herzlichen Dank für das liebe Kompliment, das mich sehr freut!
Darf Ihnen versichern, mich gibt es noch – habe indessen harte Arbeit im Hintergrund geleistet für die „Zukunft der Schweiz“ und auch entsprechende Grundlagen entwickelt – zum Teil unter widrigen Bedingungen; gut das tönt ggf hochgestochen – doch ich leide unter der Entwicklung der Schweiz, da ich trotz meines jugendlichen Alters nun Jahrzehnte „wirtschaftskriminelle“ Prozesse, Finanzkrise, SNB etcpp hautnah miterlebt habe.Das war so intensiv, dass ich kaum Zeit hatte, täglich Kommentare abzugeben.
Werde euch jedoch auf dem Laufenden halten!Bei Bachheimer.com bin ich als Silberlöwin im Team und auf IP – und generell – schreibe ich immer unter meinem Klarnamen; hoffe, mich bald wieder intensiver einzubringen, da meine Kommentare ja auf gewisse Resonanz stossen, was mich sicher freut;-)!
Meine besten Grüsse
Eva Maria Thür as Silberlöwin -
Liebe Frau Thür
Schön dass Sie wieder zurück sind und ich freue mich auf tolle Beiträge!
-
Logisch hocken die Links-Grünen wie unser Langzeit-Student „Jesus“ Glättli im Nationalrat. Der Staat bezahlt irgendwo CHF 140’000.00 für dieses Mandat inkl. Gratis 1. Kl. GA und versteuern muss man erst noch nur einen Teil dieses Einkommens was irgendwo bei CHF 75’000.00 anfängt. Ach ja und im NR-Saal muss man auch nur hocken wenn man Lust dazu hat.
Solche Leute sind wirklich keine Netto-Steuerzahler reissen aber überall den Mund auf und tun sich als Gutmenschen. Lässt sich ja „gut“ leben vom Staat gäll
Balthasar -
Noch schlimmer sind die asozialen Abzocker wie Wermuth, Molina (Ironie der Geschichte daß schon sein linksextremer Vater aus Chile vertrieben wurde) und das JUSO-#metoo-Berufsopfer aus Basel, die alle im Nationalrat sitzen, noch in ihrem Leben gearbeitet oder irgend eine sinnvolle Ausbildung abgeschlossen haben und jetzt bis an ihr Lebensende dem Steuerzahler auf der Tasche liegen werden.
Richtige Abzocker und Schmarotzer eben.
-
-
oder im Lotto gewinnen
-
Naja, es gibt noch mehrere Varianten:
1) Auswandern und auf einem ort sein, wo die Innovation etwas zählt.
Fast alle Multimiliardär der SV sind so gestartet…
2) kreative Geldschöpfung: es gäbe mehrere Möglichkeit auch in der Schweiz…
3) neue Erfolgreiche Firmen der Zukunft kreieren. So wird man mindestens Milionär…
4) legal Firmen – räuben
5) bis N) milionen von andere Möglichkeiten.
Finde ich schade, dass der Stalker jetzt auch so pessimistisch geworden ist, diese Pan- European- Swiss- disease erlebt potenzielle Wachstum! Aber, neone Damen und Herren, vergessen wir nicht Markus 8, 36: „Denn was nützt es ( dem) Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Seeleben zu verlieren? „
-
-
Die meisten superreichen Ausländer in der Schweiz zahlen eine bescheidene Pauschalsteuer. Ikea-Gründer Kamprad bezahlte gerade mal 165’000 pro Jahr, bei 42 Mrd Vermögen.
Aus der reichen Schweiz wird nicht plötzlich ein Oberitalien oder Tirol. Die Banca Lombarda und die Tiroler Landesbank haben nicht 800 Mrd Währungsreserven wie die SNB.
Buona Pasqua-
Das ist auch richtig so, denn diese „Superreichen“ bezahlen andern Ortes bereits Steuern, ja haben ihren Reichtum bereits mehrfach versteuert.
Es gibt heute klein Geld mehr welches nie versteuert wurde, ausser es ist Drogengeld oder das Resultat anderen Verbrechen. -
@Walter Roth: Auch das Geld aus Drogen und anderen illegalen Delikten nimmt der Staat gerne entgegen, nur vielleicht als ein Glied etwas weiter in der Kette, nachdem es nämlich vom Drogenboss zuerst in ein paar Luxusautos, Yacht, Häuser, Schönheitskliniken, Kunstwerke, Schmuck und Klamotten, Luxushotels etc. etc. „investiert“ wurde und bei den jeweiligen Firmen Einkommen generiert hat, mit dem Steuern und Löhne bezahlt werden, wobei letztere wieder verkonsumiert und besteuert werden. – Noch Fragen? Ich kann das Dummgeschwätz bezüglich Geldwäscherei nicht mehr hören. Die grössten Geldwäscher sind wohl Firmen wie Daimler, VW, Boeing, ABB, Siemens, Richemont etc. etc., aber da schaut dann keiner hin, natürlich.
-
-
Hach, Mr PR aus den 1980ern, wie soll ich es Ihnen schonend beibringen:
Es gibt die Option 4.
Technologie hoch Gier der Menschen machen das Leben auf dem Monte Verità sehr angenehm. Wer die letzten 12 Monate keinen ICO durchgeführt hat, ist selbst schuld. Die Welt spielt aktuell verrückt. Die Geldbeschaffung ist heute kein Problem mehr. Eher, was man damit anstellt, ohne die Erde noch mehr zu belasten. Geld und Konsum haben ihren Reiz seit dem Mainstream völlig verloren. Alle wollen reich werden. Ja und dann? Darüber machen sich die wenigsten früh genug Gedanken.Was heisst denn Normalverdiener? Das gibt es nicht. Normal wäre, wenn eine Pflegefachkraft 300k pro Jahr verdienen würde. Denken Sie an meine Worte, wenn Ihnen eine Ukrainerin in ein paar Jahren rund um die Uhr den Hintern abwischt und Ihren Kindern das nicht mehr als 800 Euro im Monat Wert ist…
-
„Wer die letzten 12 Monate keinen ICO durchgeführt hat, ist selbst schuld.“
Bitte lassen Sie uns an Ihrer Geschichte teilhaben.
Was ist das reale Underlying?
Wieviel blieb nach den Pump and Dump Zwischenhändlern für Sie noch übrig?
Haben Sie sich dadurch langfristige Verpflichtungen eingehandelt?
Wie läuft das Projekt jetzt? -
@Peter Keller
Das ist ja der Witz am ICO. Kein Realitätsbezug. Einfach ein wunderschöner Scam ohne weitere Verpflichtung. Keiner checkt den abweichenden Code zum Whitepaper. Alle sind zu gierig und lassen sich durch nettes Growthhacking und etwas Socialproof reinziehen.
-
ja, das gibt es in der Tat.
Aber ich wäre da vorsichtig.
Einerseits rechtlich (wenn es als Betrug ausgelegt werden kann) und von der Präsenz her (about us, nachvollziehbarer Wohnsitz etc.)
-
-
Hier wird einerseits das Statusproblem der oberen Hälfte der sozioökonomischen Mittelklasse thematisiert, anderseits aber auch die tabuisierte zunehmende Assimilierung des Einkommens und Vermögens mit dem europäischen Umfeld, wobei das Preisniveau immer noch sehr hoch ist. Das CH BIP pro Kopf sinkt seit Jahren.
Was ist die Kernaussage Ihres Artikels? Die zunehmend Umverteilung zu Gunsten von Superreichen? Das teure Leben in der Schweiz an sich, das für Ausländer demnach immer unattraktiver wird, wobei die armen „Schweizerli“ ohne Ausländer nicht mehr existieren könnten?
-
Falsch…………….
Ohne Ausländer sind wir gezwungen Aktiv und Erfinderisch zu sein, ohne die geht es uns bald einmal sehr viel besser wie jetzt.
Das BIP sinkt erst seitdem wie uns die Ausländer in massengeholt haben.
Natürlich florieren viele Wirtschaftszweige mit dieser Masseninvasion sehr gut, aber Innovativ erlahmen wir damit, sind wir immer weniger konkurrenzfähig.
-
-
Als Radiologe 1.5 bis 5 Millionen/Jahr ? Und das wenn möglich noch vorwiegend auf Kosten der Kassen ? Das scheint mir entweder phantastisch (im Sinne einer Phantasterei) oder, wenn es stimmt, skandalös. Dann müsste BR Berset dringendst handeln. Woher hat der Autor diese Zahlen ?
-
@Geog Stamm
Ja, Radiologen verdienen so viel, vor allem wenn Sie mit veralteten, resp. amortisierten/abgeschriebenen Anlagen arbeiten. Ähnlich viel verdienen spezialisierte selbständige Ärzte im Bereich Ästhetik. Dies ist seit mindestens 20 Jahren bis heute so.
Hausärzte z.B. im Kanton Bern verdienen meistens nicht mehr als TCHF 200 – 300.
Diese Zahlen würden Sie bei jedem spezialisieren Treuhänder für Ärzte erhalten oder seitens von Steuerverwaltungen, wenn diese die Zahlen veröffentlichen würden.Ich gehe davon aus, dass Herr Stöhlker ausländische Ärzte berät, welche sich in der Schweiz ansiedeln möchten. Ein gutes Geschäft.
-
Ich glaube nicht, dass Radiologen so viel verdienen, noch dazu, da ihnen seit Anfang 2018 das Honorar um 30% gekürzt wurde, anderen Fachgruppen nicht ganz so stark. Auf jeden Fall wurde der Tarmed, die ambulante Gebührenordnung seit 1992 nicht erhöhrt, trotz steigender Unkosten. Seit Januar diesen Jahres darf eine Arztkonsultation nur 20 Minuten betragen, mehr wird nicht bezahlt. Zu unterscheiden ist hier auch noch das Honorar, von dem alle Praxiskosten abgehen, die aber immer mehr steigen, und der Gewinn, der noch versteuert wird, und das, was nachher übrig bleibt. Ein Honorar für Radiologen in Höhe von 1 bis 2 Millionen ist möglich. Übrig bleiben mit viel Glück knapp 200 000. Damit schrammt der Radiologe knappt am Gutverdiener mit Familie vorbei. Dem durchschnittlichen Arzt in der Praxis, egal welche Fachgruppe, bleiben ca. 180 000 vor Steuern. Da darf er aber nicht krank werden, dass kann ihn in den Ruin treiben.
-
-
Verständlich, als nächster Schritt wird wohl die „Armuts“-Definition auf 100’000.-/Jahr festgesetzt.
Dass die links-grünen Abzocker und ihre bildungsfernen Wählerschaft, die ausnahmslos im staatlichen Speckgürtel rumschmarotzert den Bezug zur Realität verloren hat, ist nichts neues.
Diese Asozialen haben ja noch nie in ihrem Leben etwas geleistet, geschweige denn je einen Franken ausserhalb der geschützten Werkstatt erwirtschaftet. Da kommt einem eine neue Armutsdefinition entgegen, damit kann man wieder ein paar hundert Genossen mehr, die nach ihrem ach-so-anspruchsvollen, 38-Semestrigen Soz-Studium irgendwo ein gut bezahltes Pöstchen brauchen, unterbringen.Schrieben Sie doch mal darüber, wer eigentlich in diesem Land noch Steuern (NETTO!) bezahlt und mehr an den Staat abliefert, als durch „Transferleistungen“ zurück bekommt.
Ich bin es langsam leid, immer denselben (fehlerhaften**) Artikel* zitieren zu müssen, weil die Klepto-Ochlokratie offensichtlich ein Tabu-Thema der Schweizer Presse ist.
Selbst in der angeblich so rechten Weltwoche ist das Thema inexistent. Köppel scheint der hohe Wählerstimmanteil seiner Wahl in der Kopf gestiegen zu sein und er lebt mithin selbst in der rosa Gutmenschen-Wolke. Regelmässig schwadroniert er in seinem Editorial von der „Demokratie“ und dem „Kapitalismus“.
Beides hat die Schweiz nicht mehr: Die Wirtschaft ist hochgradig sozialistisch durchbürokratisiert und die Klepto-Ochlokratie Schweiz unterscheidet sich kein Mü von der „gelenkten“ Demokratie Russlands. Nur weil die Situation in Resteuropa noch extremer ist, hält sich ein gewissen Wohlstand hier.
Wie lange noch?
* https://bazonline.ch/schweiz/der-mittelstand-haengt-am-tropf-des-staates/story/14135710
** Der Artikel vergisst die talentfreien Subventions-„Künstler“ und -„Kulturellen“ sowie die Speckmaden der geschützten Werkstatt SRG „abzockeridée suisse“ zu erwähnen.-
Liebe Laura Stern
Ihre Kommentare finde ich meistens sehr fundiert & stringent und alles andere als Ergüsse!
Herzlichen DankManchmal muss ich schmunzeln, weil ich es ähnlich sehe;-)
Ihnen einen wundervollen Tag & beste Grüsse!
Eva Maria Thür
-
-
„Kein Wunder, dass der Druck auf die „seriously rich“ enorm zugenommen hat. Superboni gehören in der Pharmaindustrie und bei den Schweizer Banken längst der Vergangenheit an. „Niemand soll mehr als 10 Millionen Euro verdienen““
Frag sich wen man mit seriously rich meint.
Nach meinem Verständnis ist jeder der auf ein Gehalt angewiesen ist keinesfalls seriously rich.Und wenn jemand 5-10 Millionen verdient und nicht völlig verblödet ist, lebt man schon nach wenigen Jahren gemütlich vom bedingungslosen Spitzen-Einkommen (Kapitalertrag).
Zahlen als Vergleich sind ja auch nett, aber wir wissen doch, dass sowohl die BIP Zahlen Blödsinn sind als auch die wirklich Vermögendsten in keiner Forbes- etc. Statistik auftauchen…
-
Herr Stöhlker bestätigt meine Theorie, dass in der Schweiz viele Menschen materiell sehr reich sind, emotional aber mausarm sind. Gier und Neid sind Ausprägungen von mangelndem emotionalem Reichtum. Ich schreibe dies nicht aus Neid, schliesslich gehört meine Familie auch zur materiell oberen Hälfte in der Schweiz. Ich gebe mir aber grosse Mühe, auch emotional zur oberen Hälfte zu gehören, indem ich nicht nach immer mehr Reichtum strebe sondern auch versuche, dankbar zu sein und bescheiden zu bleiben.
Mein Geld soll mir dienen, ich diene nicht meinem Geld, indem ich immer mehr will. Natürlich wäre ich heute reicher, wenn ich eine reichere Frau geheiratet hätte. Das ist ja das einzig kluge, was ich aus Ihrer Sicht machen könnte, erben kann ich nicht beeinflussen und arbeiten ist dumm. Das Risiko auf eine unglückliche Ehe wäre aber viel grösser gewesen. Damit wir keine Probleme haben zuhause, würde ich noch mehr im Büro arbeiten, meine Kinder würde ich nur selten sehen, ich degradiere mich selbst zum Sponsor der Familie und meine Frau organisiert sich einen Liebhaber. Ich habe ab und zu etwas mit meiner Sekretärin, die Kinder haben schon früh „unerklärebare“ psychische Störungen und so entwickelt sich das von Herrn Stöhlke empfohlene Leben so weiter. Wir sind zwar reich, aber eigentlich geht es uns emotional sehr schlecht.
Machen Sie die Rechnung doch einmal global. Wo liegt das globale Medianeinkommen und das Medianvermögen? Sie werden feststellen, dass sogar die meisten armen Schweizer darüber liegen. Global gesehen sind also auch die materiell Armen bei uns noch privilegiert. Nur die emotional Armen werden immer das Gefühl haben, dass sie zu kurz kommen, egal wie viel Geld sie haben.
-
Stöhlker = Phantast
Einen grösseren Scheiss habe ich selten gelesen. Ist das wohl ein verfrühter Aprilscherz???-
Vielen Dank für Ihr ebenso qualifiziertes wie wohlformuliertes Urteil, Herr Paul.
Als vierte Lösung bei den Stöhlkervarianten sehe ich den Sprung in die Verwaltung oder die Kirche, da wird man auch relativ sicher vor dem immer gierigeren Staat sein. Jedenfalls bis das Gelddrucken / Schuldenmachen an sein natürliches Ende kommt und die Steuerzahler alle genug haben und weg sind. Dann wird auch die Demokratie auf den Prüfstand kommen, spätestens, da eine Schönwetterveranstaltung auf Basis von immer neuen Versprechen und nicht mehr einlösbaren Rechtsansprüchen.
Wer dann Sicherheit verspricht, wird alles bekommen vom „Volk“. Das heisst erst mal mehr Sozialismus. Aber dieses Volk wird sich in verschiedene Richtungen aufmachen, d.h. die Zentralsstaaten werden durch Separationsbewegungen unter Druck kommen. Gut so – mehr Wettbewerb heisst mehr Bewegung und schliesslich weniger Sozalismus.
-
Exgüsi: Warum so unflätig (und das am Karfreitag)? Die schwer bestreitbaren einkommens- und vermögensseitigen Fakten werden von Herrn Stöhlker pointiert dargestellt, diesmal nicht nur ein A-und-B-Schweiz sondern ein 4-Zylinder-Motor mit resigniert auf den Sozialstaat hoffenden Armen, idealistisch sich selbsteinschränkende Ökos, aufwärtsstrebenden den Weltwettbewerb suchende Dynamikern und weichgebettete konkurrenzverschonte Profiteure. – Ich finde, Herr Stöhlker freue mich über Herrn Stöhlkers Osterei. Find es allemal spannender das hier gratis in IP ui lesen als in Hochglanz in der Bilanz oder in Bleiwüsten wie NZZ oder WoZ.
-
Die Fäkalsprache zeigt das Niveau
-
Ich finde es dagegen total richtig!!¨
-
Glaub der letzte Absatz im Artikel war der sarkastistische Aprilscherz…
-
-
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit (kombiniert mit der dritten): sich vom Tanz ums goldene Kalb verabschieden, sich auf den Sinn des Lebens konzentrieren, nicht alles über Zahlen und Statistiken erfassen, sondern das mit Überzeugung tun, was andere am nötigsten haben und letztlich die Gesellschaft alleine weiterbringt (Albert Schweitzer, Beat Richner, Ruedi Lüthi, Ernst Sieber, Lotti Latrous u.a.m. lassen grüssen).
-
Vor gerade noch 12 Jahren ging es in der Schweiz noch darum, daß man von den Zinsen seines Kapitals leben könne, ohne dieses anzugreifen:
FAZ Sonntagszeitung vom Oktober 2006:
UMGANG MIT GELD – Von den Zinsen leben
VON HEINZ BRESTEL / / An der Zürcher „Goldküste“, wo die wohlhabenden Schweizer leben, kursiert ein schöner Witz. Da treffen sich zwei alte Damen …
Inzwischen werden Häuser gebaut, in denen das Stockwerkseigentum sFr 1,0 Mio. kostet – also das, was früher bereits ein großes Vermögen war – wo man die Parkplätze zur Förderung des ÖPNV nur noch einmal am Tag verlassen darf:
Und nein, es ist kein Aprilscherz!
Ziel ist die „2000-Watt-Gesellschaft“, also daß der Einzelne mit moderner Technik, die viel Geld kostet und zu deren Herstellung Energie notwendig ist, was aber offensichtlich nicht eingerechnet wird, seinen Energieverbrauch reduziert:
https://de.wikipedia.org/wiki/2000-Watt-Gesellschaft
D. h. man gibt viel Geld für wenig aus bzw. das, was es anderswo im Überfluß und preiswerter gibt, da speziell die USA preiswerte Energie zum Ziel des nationalen Wirtschaftens erklärt haben:
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5244456/Trump-pfeift-auf-erneuerbare-Energie
Vergleichbar sinnlos ist die deutsche „Energiewende“, wo alle Privaten (jedoch nicht die Industrie) von Staats gezwungen werden, für Strom mehr Geld zu bezahlen ohne daß eine CO 2 – Reduktion erreicht wird:
http://mediathek.cesifo-group.de/iptv/player/macros/cesifo/mediathek?content=2959393&singleton=true
Unabhängig davon, daß der elektische Strom nur 25% des Gesamtenergiebedarfs einer Volkswirtschaft ausmacht, der im wesentlichen vom Energieverbrauch für Verkehr, Heizung und industrielle Prozeßwärme bestimmt wird.
Praktikable (!) regenerative Lösungen dafür sind in noch weiterer Ferne.
Entsprechend ist ohne staatliche Subventionen nicht gut wirtschaften:
http://www.zeit.de/wirtschaft/2018-03/frank-asbeck-solarworld-insolvenz
Letztendlich ist die aktuelle Null- und Niedrigzinspolitik nur das äußere Anzeichen eines allmählich niedergehenden Industrielandes.
Man ist nun ungefähr dort, wo sich Japan bereits um 1995 befand. Natürlich will man nicht den japanischen Weg gehen, aber gemessen an der Aufrichtigkeit und Halbwertszeit von politischen Aussagen bin ich relativ sicher, vergleichbares in Europa zwei bis drei wirtschaftliche Krisen später – noch zu meinen Lebzeiten – zu erleben:
https://img.shz.de/img/incoming/origs15811976/5734963168-w600-h450/imago54514484h.jpg
In diesem Zusammenhang wundert auch nicht, daß die Architekten dieses Irrsinns in ihren Amtsstuben zur gut bezahlten neuen (Gutmenschen-)Kleptokratie gehören.
Entsprechend ist das Beamtentum nun berufliches Ziel Vieler:
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/studenten-wollen-zunehmend-in-den-staatsdienst-14409966.html
Die große Frage über all dem, zu dem ich übrigens auch die sog. „Flüchtlingspolitik“ entgegen der geltenden Rechtslage zähle ist, für welchen gut ausgebildeten (die sog. „Fachkraft“) bzw. Kapital besitzenden Fremden dies alles noch so attraktiv ist, daß er hierher zieht und sich nicht einen anderen Platz in der Welt bzw. Steuerstandort sucht.
Anstatt daß wie früher beispielsweise in Japan und aktuell in China von Staats wegen große Anstrengungen dahin unternommen werden, Wirtschaftskraft und Produktivität der Gesellschaft deutlich anzuheben, womit solche Ideen mittelfristig immerhin bezahlbar würden:
-
If you steal,
do not steal too much at a time.You may be arrested.
Steal cleverly,
little by little.Mobutu Sese Seko
* 14. Oktober 1930 † 7. September 1997
-
-
„500 bis 1’000 Mitarbeiter von UBS und CS dürften eine Million Franken im Jahr und mehr verdienen“ – alles in der SCHWEIZ beschäftigte ?
-
Vielen Dank Herr Stöhlker für die wirklich gute „Oster-Story“, habe sie aufmerksam gelesen und ob dem letzten Abschnitt schallend gelacht. Lachen gehört ja auch zum Auferstehungs-Fest. Freundlichen Gruss

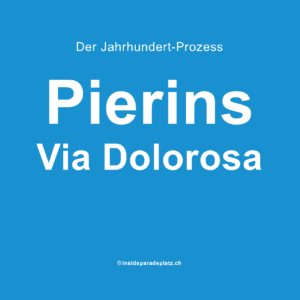

@Laura Stern alias Samira Courti Müssen Sie Ihre immer gleiche Ergüsse über Klepto-Ochlokratie wirklich überall posten? In diesem Ausmass über…
Verständlich, als nächster Schritt wird wohl die "Armuts"-Definition auf 100'000.-/Jahr festgesetzt. Dass die links-grünen Abzocker und ihre bildungsfernen Wählerschaft, die…
Liebe Laura Stern Ihre Kommentare finde ich meistens sehr fundiert & stringent und alles andere als Ergüsse! Herzlichen Dank Manchmal…