Im Umgang mit Behörden oder Banken trifft man ihn manchmal an: den Datenschutz. Fragt man bei Banken an, welche Mitarbeiter kürzlich entlassen wurden, wird man freundlich auf den Datenschutz verwiesen, der angeblich die Bekanntgabe von Mitarbeiterdaten nicht erlauben würde. Fragt man weiter nach, wird gestützt auf den Datenschutz behauptet, dass die betroffenen Mitarbeiter zuerst ihre Zustimmung geben müssten, damit die Daten über sie herausgegeben werden dürften. Das stimmt im Grunde. Überprüfen kann man das aber freilich nicht. Die Mitarbeiter sind nicht bekannt und die Medienstelle der Bank kann Behauptungen aufstellen, ohne dass man diese verifizieren könnte.
Wiederum kann der Datenschutz aber à la George Orwell oder im Zuge des internationalen Kampfes gegen den Terrorismus umgangen oder ins Gegenteil verkehrt werden, wenn behauptet wird, dass aus prophylaktischen Gründen Mitarbeiterdossiers angelegt und Personen oder Mitarbeiter überwacht und Geldtransaktionen zurückverfolgt werden müssen.
Ein Fall bewegt seit kurzem die Gemüter: Die ZKB-Geschäftsleitung habe aufgrund einer Verletzung einer internen Richtlinie die IT-Abteilung dafür gebraucht, um an die Personendaten ihrer Mitarbeiter heranzukommen, die ihre Meinung im Internet geäussert haben. Manchmal geht es so weit, dass eine Bank den Datenschutz beim Kunden und bei den Mitarbeitern aushebeln möchte, um zum vornherein sich vor Rufschädigungen und schlechtem Image zu schützen und zuletzt just wegen ihres Verhaltens öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Das Öffentlichkeitsgesetz des Bundes und ein Whistleblowergesetz sind nützliche Instrumente
Am 1. Juli 2006 trat das eidgenössische Öffentlichkeitsgesetz in Kraft. Dieses erlaubt es jeder Person (Schweizer und Ausländer), ohne Zwang zur Motivnennung einen Aktenzugang bei Behörden und Ämtern zu stellen, die dem Öffentlichkeitsgesetz unterstehen. Man kann damit Ämter zu Antworten zwingen, die sonst keine Antwort geben wollen. Dieses Gesetz und ein noch umzusetzendes Gesetz für Whistleblower sind notwendig, um die Balance zwischen mündigem Bürger und Organisationen mit viel Macht oder Einfluss auszutarieren und schwächere Glieder der Gesellschaft vor Amtsmissbrauch, Repressionen und Korruption zu schützen.
Es gibt natürlich noch weitere Gründe, doch die genannten sind die wichtigsten. Ein Whistleblower untersteht dem Daten- und Quellenschutz, welcher den Whistleblower bei einer Aufdeckung, Veröffentlichung oder Meldung von Missständen schützen sollte. Der Name des Whistleblowers muss geheim bleiben, seine Informationen müssen aus Fakten bestehen, die losgelöst von seinem Fall oder seiner Person untersucht und verifiziert werden können.
Beispielsweise bei Banken, Verwaltung oder Gerichten ist dieser Schutz notwendig, da der Arbeitgeber oder das Amt zugleich auch Auslöser für den möglichen Druck auf den Whistleblower sein kann, oder es könnte sich dabei um die zuständige Stelle handeln, die wiederum sich selber bewertet oder über ihre „Fehlbarkeit“ entscheidet. Das geht natürlich nicht. Das Argument, dass bisher kein Fall eines Missstandes auftrat, für den es ein Whistleblowergesetz bräuchte, gilt ebenfalls nicht. Erinnert sei an den Mitarbeiter und Analyst der Credit Suisse, der lange vor dem Swissair-Grounding warnte und daraufhin entlassen wurde.
Erinnert sei auch an die zwei Sozialamt-Mitarbeiterinnen in Zürich, die aufgrund ihrer Geschäfts- und Dossiergeheimnisverletzungen gebüsst wurden, aber erst dadurch den Stein ins Rollen brachten, um Missstände zu beheben, worauf schliesslich eine Amtsvorsteherin zurücktreten musste. Beim AHV-Schwindel wurde der Steuerzahler in den Jahren ab 1996 um Milliarden geprellt und keiner schaute hin, auch die Politik deckte diesen Missstand. Der Entdecker des AHV-Schwindels durfte damals die Verträge zwischen der AHV und den Bank- und Versicherungsmanagern nicht veröffentlichen, um auf die Missstände aufmerksam zu machen, da er sich sonst einem Strafverfahren wegen Amtsgeheimnis- und Geschäftsgeheimnisverletzungen ausgesetzt hätte.
Hätte man vor dem Swissair-Grounding mehr gewusst, dann hätte der Steuerzahler vielleicht gar nie zur Kasse gebeten werden müssen. Hätte man vor dem UBS-Abkommen gewusst, dass die UBS krumme Geschäfte in den USA mit Umgehung von US-Gesetzen vorantrieb, dann hätte man die US-Geschäftsteile der UBS vorher abspalten und rechtlich auslagern können.
Datenschutz darf nicht mit Geheimniskrämerei, das Whistleblowing darf nicht mit „unangebrachten Beschuldigungen“ verwechselt werden. Beide Begriffe sind gesetzlich zu regeln und es ist eine unabhängige Stelle zu schaffen, die jedem Hinweis nachgehen kann, um falsche Vorwürfe von richtigen zu unterscheiden, um keine Papiertiger entstehen zu lassen.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Die Idee hinter dem Öffentlichkeitsgesetz war für den Gesetzgeber damals, eine transparentere und kontrollierbare Verwaltung für den Bürger zu schaffen; damit beispielsweise keine Ämter hinter dem Rücken der Bürger Dinge beschliessen oder Ausgaben tätigen können, wofür diese nicht befugt sind; dass statistische Prozesse und amtliche Prozesse nachvollziehbar bleiben und die Arbeit der Behörden überprüft werden können; dass es keinen Fichen-Fall wie in der Vergangenheit mehr gibt.
Das Öffentlichkeitsgesetz im Kanton Zürich ist auf die Kantonsverfassung des Kantons Zürich (Art. 17 KV Informationsfreiheit) und das Informationsgesetz IDG abgestützt. Eine Kantonalbank, die vom Kantonsrat jedes Jahr beaufsichtigt wird, und deren Geschäftsberichte jährlich verabschiedet werden müssen, untersteht genauso der Kantons- und Bundesverfassung, wie sie auch dem kantonalen und eidgenössischen Datenschutzgesetz untersteht. Sie hat daher auch einen Vorbild-Charakter, was ihr Geschäftsgebaren betrifft.
Kündigung zweier ZKB-Mitarbeiter wegen freier Meinungsäusserung oder Loyalitätsproblemen?
Kommen wir zum Punkt, um den es hier geht. Wenn Banken versuchen, ihre Mitarbeiter mit Reglementen und Richtlinien an die kurze Leine zu nehmen, dabei zugleich die konstruktive Kritik und Mitarbeiterkreativität abwürgen, so dürfen die Banken das nur innerhalb der gesetzlichen Spielräume. Denn: Landesrecht bricht Hausrecht, Bundesrecht bricht Landesrecht. Und die Grundrechte sind unantastbar. Es gibt verbriefte Grundrechte auch für Bankenmitarbeiter. Darunter fallen Art. 5 BV (Recht auf Freiheit und Sicherheit), Art. 10 (Freiheit der Meinungsäusserung), Art. 9 (Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit).
Wenn eine Bank in ihren internen Richtlinien für die Mitarbeiter versucht, die Meinungsfreiheit zu beschneiden, so handelt sie illegal. Die Bank darf auch nicht den Datenschutz von sich aus selber aushebeln. Die Bank und (auch die meisten öffentlichen Ämter) sind verpflichtet, Mitarbeiter- und Personendaten zu schützen, sofern die betroffenen Mitarbeiter nicht angefragt wurden, um deren Erlaubnis für eine Herausgabe ihrer Personendaten zu erhalten. Einzige Ausnahmen sind begründete und gut belegte Hinweise auf Vergehen der Mitarbeiter wegen Geschäftsgeheimnisverletzungen oder strafrechtliche Zuwiderhandlungen. Ansonsten dürfen Mitarbeiterdaten nicht nachrichtendienstlich oder mittels Umgehung einer EDV-Anlage ermittelt werden.
Der Artikel 102 des Strafgesetzbuches ist deutlich: „Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Verbrechen oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet. In diesem Fall wird das Unternehmen mit Busse bis zu 5 Millionen Franken bestraft.“ Gemäss Artikel 7 Datenschutzgesetz dürfen Unbefugte keinen Zugriff auf geschützte Daten erlangen: „Personendaten müssen durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt werden.“
Es gibt ähnliche Fälle, bei denen der Kunde nicht über sein Recht aufgeklärt wird
Banken machen gerne von ihrem Hausrecht Gebrauch. Doch nicht alle AGB (Allgemeine Geschäftsbestimmungen) und Richtlinien der Banken für ihre Mitarbeiter oder Kunden sind deswegen gültig oder statthaft. In einem Fall, den der Tages-Anzeiger kürzlich beschrieb, wurden Bestimmungen in die AGB gegenüber dem Kunden aufgenommen, obwohl diese AGB nicht Bundesrecht und höheres Recht uminterpretieren oder umbiegen können. Dahinter steckt die Absicht, den Kunden im Ungewissen zu lassen oder seine Ansprüche zu vernebeln, damit diese zu einem späteren Zeitpunkt verfallen.
Auszug: „Retrozinsen werden von den meisten Banken ihren Kunden vorenthalten. Retrozinsen sind Kommissionen, die Banken und Vermögensverwalter beim Vertrieb und Halten von Anlageprodukten kassieren. Gemäss Bundesgerichtsurteil gehört dieses Geld den Kunden. Viele Banken machen einen Verzicht auf Rückerstattung ihrer Kunden geltend. Diese hätten aus freien Stücken ihren Verzicht auf Entschädigungen bekundet. Tatsache ist, dass die meisten Banken nach einem ersten Bundesgerichtsurteil im Jahr 2006 solche Verzichtsbestimmungen in ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) aufgenommen haben. Nach der Einschätzung bankunabhängiger Juristen ist das rechtlich irrelevant. Die Berner Rechtsprofessorin Susan Emmenegger hielt bereits 2007 fest, dass „die AGB keine genügende Grundlage für einen gültigen Herausgabeverzicht bieten“. Dennoch lehnen Banken wie Pictet oder Coutts die Rückzahlung von Kommissionen mit dem Hinweis auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab.“
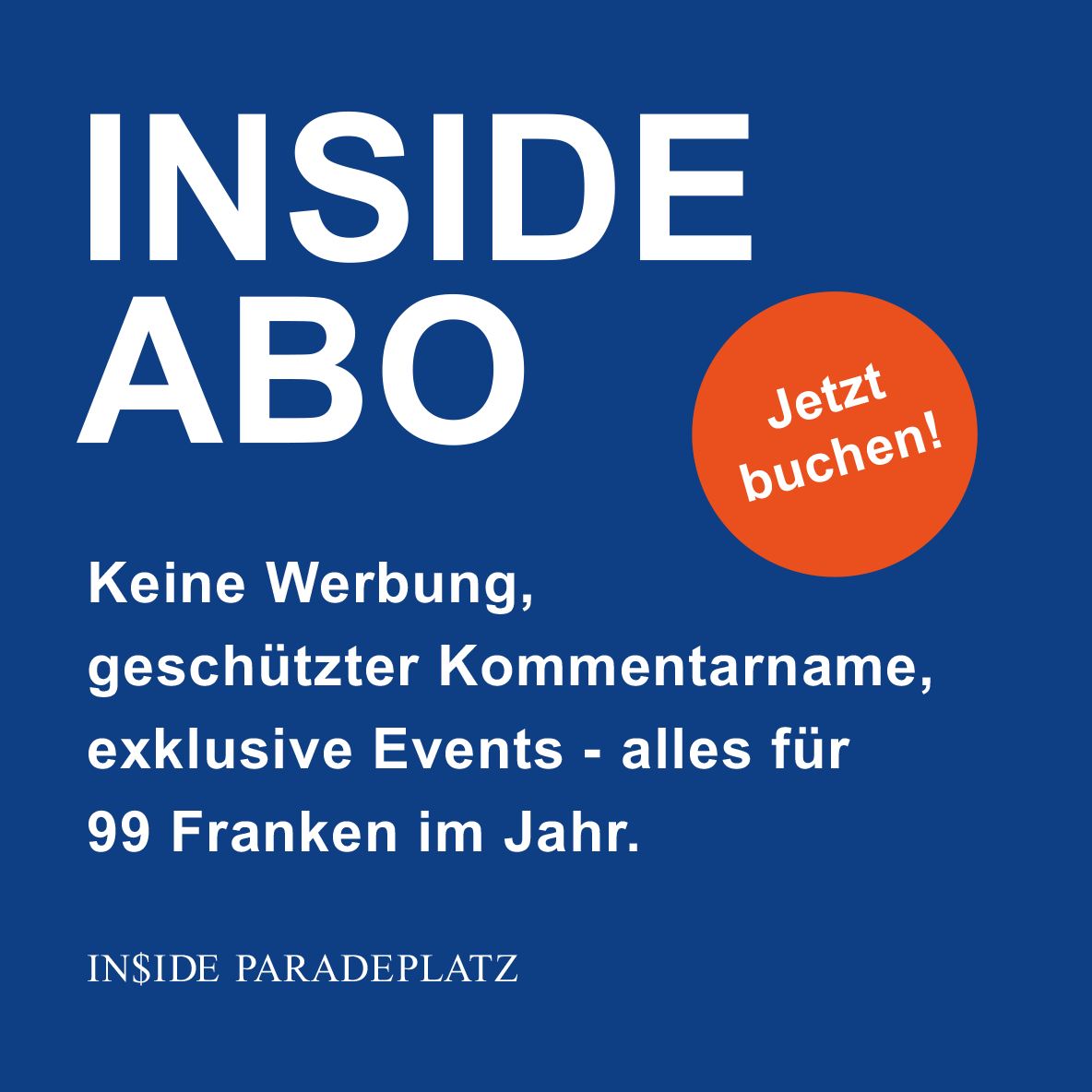

Bürgerrechtler = Warmluftventilator?