Es gibt Worte, die lösen bei gewissen Leuten sofort Ausschläge aus. Volkskultur ist eines davon.
Kaum ausgesprochen, beginnt bei manchen das innere Warnlämpchen zu blinken: „Achtung, rückständig! Vorsicht, völkisch! Wahrscheinlich ein rechter Spinner.“
Der hat vermutlich auch ein Anker-Bild über dem Sofa hängen; nicht etwa ein Original, das bleibt der Sammlung Blocher vorbehalten.
Sondern einen Kunstdruck, der – so die Vorstellung mancher – als Beleg für eine gewisse geistige Provinzialität gilt.
Ich habe das mehr als einmal erlebt. Besonders deutlich wurde es, als ich einige Jahre in Burgdorf das Haus der Volkskultur leitete.
Ein Ort für gelebte Traditionen, Handwerk, Musik, Bräuche. Es war nie als Heimatmuseum gedacht, sondern als Plattform für Austausch, Begegnung, Weiterdenken.
Und doch: Kaum sprach ich im städtischen Kulturbetrieb über das Projekt, war da oft diese Mischung aus mildem Spott, stiller Herablassung und vorsorglicher Distanzierung.
„Volkskultur? Aha. Also eher so ländlich. Etwas gestrig, oder?“
In solchen Momenten wurde mir klar: Die Ablehnung ist meist weniger inhaltlich, sondern reflexartig. Man weiss gar nicht genau, was gemeint ist – aber man weiss ganz genau, dass man dagegen ist.
Hier liegt eines der grossen Missverständnisse staatlicher Kulturpolitik: Sie setzt Kunst und Kultur gleich, als gehörten sie automatisch zusammen.
Doch das ist ein Trugschluss.
Kultur ist in Traditionen verwurzelt. Sie stiftet Zugehörigkeit, Herkunft, Identität. Sie bewahrt, was sich über Generationen als tragfähig erwiesen hat.
Gerade in unsicheren Zeiten bietet sie Orientierung.
Kunst dagegen folgt einem anderen Impuls. Sie hinterfragt das Gegebene, stört das Vertraute, rüttelt an Überzeugungen.
Wo Kultur Regeln stärkt, bricht Kunst sie auf. Wo Kultur Gemeinschaft bildet, stellt Kunst den Einzelnen mit all seiner Widersprüchlichkeit in den Mittelpunkt.
Sie will irritieren, provozieren, infrage stellen – oft genau dort, wo Kultur an ihre Grenzen stösst.
Die beiden Sphären verfolgen also nicht nur unterschiedliche, sondern vielfach gegensätzliche Ziele. Deshalb wäre es sinnvoll, sie differenziert zu betrachten.
Wer Kultur nach den Massstäben der Kunst beurteilt – oder umgekehrt –, wird beidem nicht gerecht.
Und wer Volkskultur allein mit dem Blick der Konzeptkunst analysiert, übersieht ihren inneren Wert.
Nicht alles, was nicht provoziert, ist seicht. Nicht alles, was berührt, ist kitschig. Und nicht alles, was Bestand hat, ist rückwärtsgewandt.
In all den Jahren habe ich Volkskultur nie als verstaubte Folklore erlebt, sondern als ein lebendiges, eigenständiges System.
Eine Ausdrucksform, die sich etwas bewahrt hat, das dem urbanen Kulturbetrieb zunehmend verloren geht: Unabhängigkeit.
Volkskultur funktioniert ohne PR, ohne Subventionen, ohne Feuilletonkritik. Sie lebt, weil Menschen sie leben.
Gemeinsam singen, werken, musizieren, feiern. Ohne Medienhype. Ohne Businessplan.
Vielleicht ist es genau das, was irritiert: Dass etwas Bestand hat – auch ohne Bühne.
Ich erinnere mich an eine Stubete in einer urchigen Beiz im hintersten Emmental: ein schlichter Raum, Holztische, Schwyzerörgeli, Langnauerli, Kontrabass.
Einer begann zu spielen, andere stimmten ein. Kein Programm, keine Bühne, einfach Musik.
Jeder durfte mitmachen. Keine Inszenierung, kein Performance-Konzept, kein staatlich kuratiertes Diversity-Vergabeverfahren.
Einfach nur Zusammensein. Und doch war alles da: Tiefe, Freude, Geschichte, Verbundenheit.
Diese Art von Kultur braucht keine Kritiker – denn das Publikum selbst ist der Massstab. Wer schlecht spielt, wird nicht zerrissen, sondern schlicht überhört.
Es zählt nicht das Konzept, sondern das Können. Und dieses wächst nicht durch Theorie, sondern durch Erfahrung und Teilnahme.
Mich stört nicht die städtische Kultur an sich, sondern der Anspruch mancher, sie sei die einzig legitime.
Dass alles, was nicht mit Theorie, Ironie und Grenzüberschreitung arbeitet, automatisch als dumpf oder rückwärts gilt. Das ist nicht aufgeklärt – das ist geistig eingehegt.
Wir sollten wählen können. Kulturen machen Angebote; sie zwingen nicht. Ich kann ein Jodellied schätzen, ohne in Tracht herumzulaufen.
Ich kann mich für eine alte Erzähltradition begeistern, ohne gleich einen Heimatroman zu schreiben. Es geht um Möglichkeiten, nicht um Etiketten.
Denn: Wahre Freiheit besteht nicht darin, sich möglichst weit vom „Traditionellen“ zu entfernen.
Sondern darin zu wissen, was zur Verfügung steht. Nur wer seine Optionen kennt, kann wirklich wählen.
Und dafür braucht es beides: das Neue und das Alte, das Urbane und das Ländliche, die Brüche und die Bindungen.
Wenn wir Volkskultur auf folkloristische Klischees von braunem Filz, Örgeli-Idylle und nostalgischer Heimat-Sentimentalität reduzieren, sagen wir mehr über unser eigenes Unvermögen aus als über die Volkskultur selbst.
Ich wünsche mir einen offeneren Blick. Einen, der nicht zusammenzuckt, wenn jemand ein Zäuerli anstimmt.
Und der erkennt: Kultur ist nicht dann lebendig, wenn sie neu ist – sondern wenn sie getragen wird. Von Menschen, nicht von Konzepten.
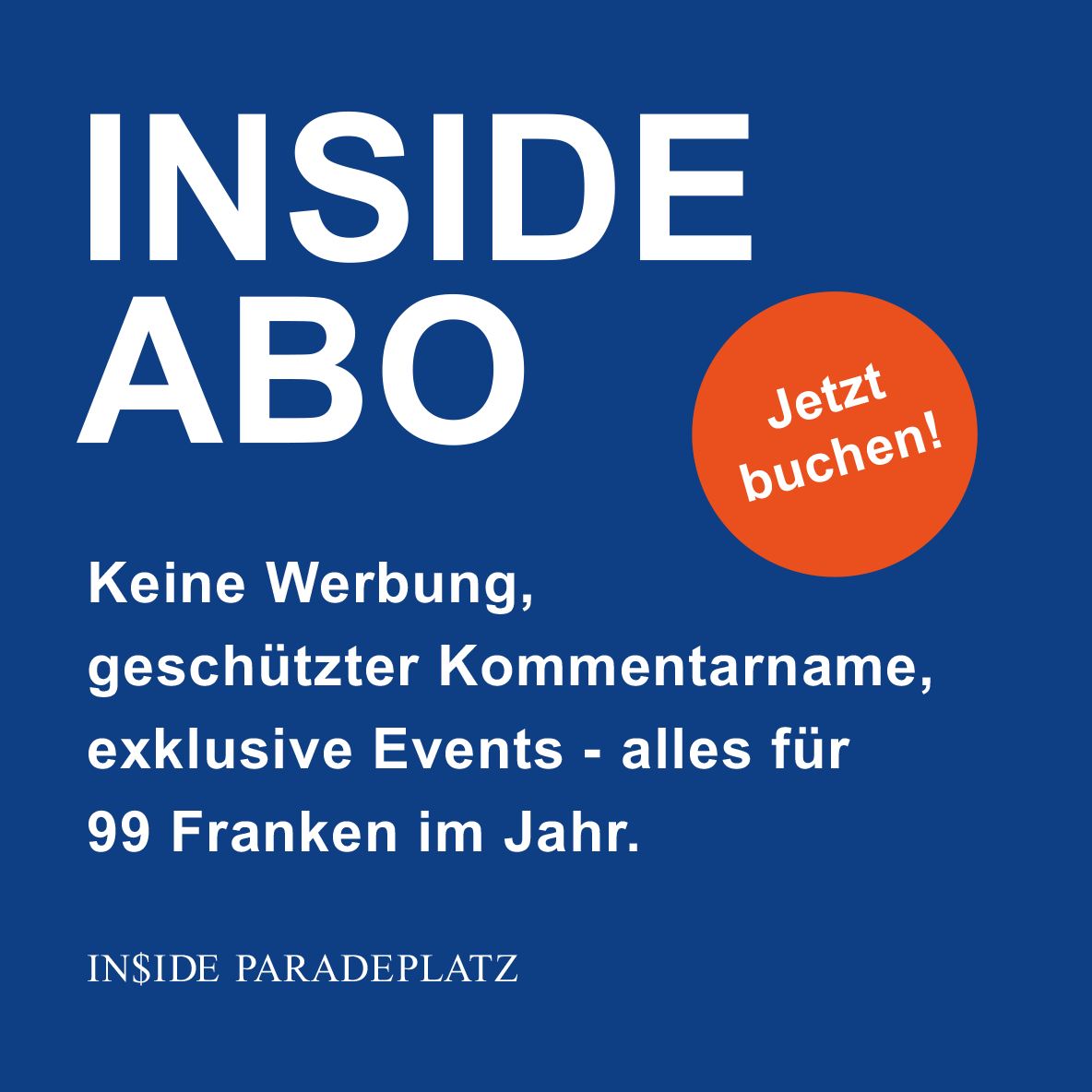
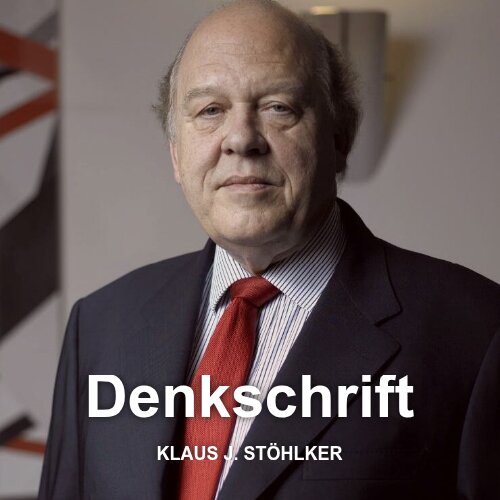
Volkskultur, freiheitlicher Begriff mit Überraschungeffekten ähm Überraschungsdefekt.
jaaaaa früher war alles besser.echt etz
Habe es vermutet, dass der text dich überfordert. Es geht nicht um früher oder das jetzt, aber heey, egal chef 🙂
Keine Sorge, chef – die Vergangenheit will Ihnen keiner zurückgeben. Man muss halt schon genau lesen, um zu merken, dass es hier nicht um Nostalgie geht, sondern um kulturelle Tiefenschärfe. Für manche vielleicht schon zu viel verlangt.
Wer definiert denn, was zur Volkskultur gehört? Welches sind die Kriterien?
Was bietet die Volkskultur in Sachen Musik nebst Hudigäggeler, Jodel und Alphorn? Gehört Mani Matter dazu? Wenn nein, wieso nicht? Mundartrock? Gibt es auch schon seit über 50 Jahren und wird von einer grossen Menge Menschen gehört. Celtic Frost, Vorreiter in Black/Death Metal vor gut 40 Jahren, weit über die Grenzen bekannt?
Die „Monday Jam Sessions“ in der Helvti-Bar in den 90ern war genau das: Einer fängt an, es kann mitmachen, wer will. War meistens sehr gut – und auch sehr gut besucht. War das Volkskultur oder eher nicht, weil es Pop/Rock/Jazz/Funk und nicht Hudigäggeler war und nicht im hintersten Chrachen im Emmental stattfand?
Danke für die berechtigte Nachfrage. Der Begriff Volkskultur ist tatsächlich unscharf und wissenschaftlich umstritten. Ein hilfreiches Unterscheidungsmodell stammt aus der US-amerikanischen Kulturforschung: Demnach wird Volkskultur nicht schriftlich oder medial vermittelt, sondern mündlich, gemeinschaftlich und durch Nachahmung. In diesem Sinn kann auch ein Teil der Mundartmusik, wie etwa Mani Matter, dazugehören – je nach Kontext und Vermittlungsform. Volkskultur ist kein fester Kanon, sondern ein dynamischer Prozess. Nicht alles passt hinein, aber es lohnt sich, genauer hinzusehen, bevor man ausschliesst.
Chill it, wüst und wirr hatte nie die Chance mit der Zeit zu gehen.
Hauptsache, gewesen zu sein, muss reichen im Leben.
Herrlich geschrieben! Sie und Herr René Zeyer sind für mich jedes (nicht nur hier) Wochenende der Aufsteller (und darüber hinaus…). Herzlichen Dank für Ihre klugen und humorvollen ( wie René Zeyer) Beobachtungen. Vielen Dank
Ja, das stimmt. Herr Gutschein und R.Zeyer schreiben wirklich nicht wie die 20minuten (20 Millisekunden…;-)) Journalisten sondern für die Leser mit etwas mehr „Grips“ im Gehirn…
Danke vielmals
Dann schreibt Zeyer also nicht für Sie. Da ist höchstens „Gips“ im Kopf und das nicht zu knapp.
Schliesse mich (und wahrscheinlich viele anderen auch) an. Herr Gautschin (und „RZ“) zählen zu den besten Ip-Autoren…Lektüre geht halt weiter als 20 Sekunden (pardon 20 Minuten ;-)😉)
Chill it, wüst und wirr hatte nie die Chance mit der Zeit zu gehen.
Hauptsache, gewesen zu sein, muss reichen im Leben.
Schon gar nicht im 2025 wo auch berühren die Todesstrafe bedeutet, ihr ach so lieben zartbeseelten Wegwerfgeschöpfe.
Herr Gautschin,
Ihre Artikel sind immer hervorragend.
Weder Gautschin noch Zeyer finde ich interessant.
@IP macht keine Freude mehr
Man kann nicht jeden erreichen. Aber danke, dass Sie es gelesen haben.
Vielleicht lese ich ja mal etwas von Ihnen
Wird die indigene Bevölkerung der Schweiz bekämpft?
Kommt drauf an, ob sie von Wirtschaftsflüchtlingen aus dem Muotathal abstammt.
In USA nicht mehr. Steht uns sehr wahrscheinlich auch noch bevor. Was nicht heissen soll, dass es schlecht ist, die „indigene Bevölkerung“ zu stärken.
Liebe Wahlbeobachterin,
Ihre Frage ist ungewöhnlich formuliert, aber sie berührt einen wunden Punkt. Wenn Sie mit „indigener Bevölkerung“ jene Menschen meinen, die hier seit Generationen leben und deren kulturelle Ausdrucksformen wie Stubete, Handwerk oder Naturjodel oft als „rückständig“ oder „peinlich provinziell“ gelten, dann lautet die Antwort: Nicht bekämpft – aber schleichend entwertet. Nicht mit Gewalt, sondern mit hochgezogener Augenbraue.
Man nennt das auch kulturelle Deklassierung. Und die ist oft wirksamer als jede Zensur.
Kultur und Identität heute wird in Marketingabteilungen sozialer Netzwerke und Konzernen kreiert. Das kommt nicht gut. Im Gegenteil gehen bereits viele jungen Menschen drauf und verbaschieden sich und Alte werden durch Armut zernagt und es bleibt am ende nicht mal mehr etwas zurück das sich zu vererben lohnt.
Es braucht halt ausgesprochen viel Fantasie, auf die Idee zu kommen, irgendjemand käme auf die Idee, bei einer Stubete ein staatlich kuratiertes Diversity-Vergabeverfahren zu fordern, wie wenn ein solches im übrigen überhaupt irgendwie vorgeschrieben oder definiert wäre.
Aber irgendwie musste der Dünkel, der sich dabei von demjenigen der dem „städtischen Kulturbetrieb“ unterstellt wird in keiner Weise unterscheidet, ja untergebracht werden.
Lieber Herr Grimm,
dass Sie meinen ironischen Seitenhieb auf gewisse Zeitgeister zu einem realpolitischen Antrag umdeuten, ehrt Ihre Fantasie – übertrifft aber deutlich meine. Niemand fordert bei einer Stubete ein staatlich kuratiertes Diversity-Vergabeverfahren. Die Pointe war vielmehr, dass gewisse Diskurse im städtischen Kulturbetrieb gelegentlich genau diesen Eindruck erwecken – zumindest dann, wenn sie das Echte, Ungeglättete und Spontane nur noch mit spitzen Fingern anfassen. Vielleicht lag da der Dünkel? Nicht bei der Stubete – und auch nicht in meinem Text. Sondern dort, wo man Ironie nur dann erkennt, wenn sie auf Etikette gedruckt ist.
Eben, Herr Gautschin. Sie werfen einfach wieder einen Kampfbegriff als Dogwhistle in die Runde, und im Zweifelsfall ist es dann halt nicht so gemeint, faute de quoi „Ironie“. Und nein, es ist nicht der Empfänger, der für die Botschaft verantwortlich ist. Und wer genau fasst das Echte, Ungeglättete und Spontane nur noch mit spitzen Fingern an?
Interessanter, gut geschriebener Artikel. Was ich beim Thema „Volkskultur“ kritisch sehe, ist das Feiern einer (vermeintlichen) Kontinuität. Kontinuität von Ort, Beruf (meist Landwirtschaft oder Handwerk), Sprache (lokaler Dialekt), Religion, etc. Natürlich gibt es Menschen, die in so einer Welt leben. Was ist aber mit jenen (ich gehöre dazu), deren Leben von radikalen Brüchen geprägt ist, deren Kultur sich folglich ganz anders darstellt? Nicht der von Generation zu Generation vererbte Hof, sondern zB Krieg/Vertreibung, Neuanfang am neuen Ort, Aufstieg mit modernem Job, Auto, Einfamilienhaus, Studium der Kinder, etc. Das ist natürlich nicht so malerisch wie ein Hof im Emmental oder eine Appenzeller Tracht. Aber die Lebensrealität Vieler, die sich über Jahrzehnte zu einer Kultur entwickelt hat. Ungewollt, ungeplant, erst im Rückblick langsam erkennbar.
Verschiedene Lebenswelten, welche problemlos zusammen existieren können, als Gegensätze konstruieren, wo keine sind, und diese dann bewirtschaften.
Um es politisch auszudrücken: Linke Aktivitäten sind staats-, demokratie- und gesellschaftszersetzend.
Wenn Kultur Ausdruck einer Ideologie ist, wird sie schnell
zur Unkultur. Es gibt keine freiheitlichere Kunstrichtung
als die Musik. Dass gerade Musik innerhalb der eigenen Familie
zu Streit führen kann,ist nichts Neues.
Kultur lebt von Freiheit und gegenseitiger Toleranz.
Nichts ist schädlicher als Einseitigkeit in den Kunstrichtungen.
Nicht umsonst wird in Diktaturen vorgeschrieben, was gehört,
gelesen und gesagt werden darf. (zb. entartete Kunst)
Unser ehemaliger Primarlehrer zwang uns Dietrich Fischer-Dieskau
auf. Als ich gähnte und von Eric Burdon und den Animals träumte,
wurde ich vor die Schulzimmertüre gestellt.
Diese Erfahrung hat mich bis heute geprägt. Zum Glück durfte unsere
Generation die Explosion der damaligen Pop-Kultur erleben.
Es lebe: Bach, CCR Ludwigvan, Heino, Gluck, Charles Aznavour,
Oeschs die 3. Rachmaninov………….
👍guter Artikel, wertvolle Gedanken zum Thema – thanks ✌️🙏🏼☘️
Add on:
Die „kulturelle Vielfalt“ ist so bunt, neu und anders geworden, da die Summe aller „externen Einfluesse“ schneller & staerker waechst resp. sich vermischt, als unser begrenzter KulturRückspiegel zukuenftig zu fassen vermag. Kultur wird auch immer schneller vergaeglicher, ueberholt, unuebersichtlich bis zT völlig ueberfluessig & sinnlos.
👉Selber was im Kleinen machen/beitragen ist was jeder täglich tun kann. Ohne Budgets.
😎 Hier mein kleiner, musikalischer Beitrag Re: unsere langjaehrige, tief verwurzelte „Auto-Kultur“ im Lande der guten Alpenluft 👍🥳
Here we go mit dem Kulturbeitrag zur CH Alpenluft 👍✌️
https://youtu.be/iMnTaFp3irg?si=qn5feYEvncEa1u2l
Lieber Herr Gautschin
Hab Ihren (wie die von „RZ“) SCHON zweimal gelesen. Herzlichen Dank und noch einen schönen Sonntag!
Passend zu diesem Artikel das Trio Ambäck. Live eine Wucht, Heimatmusik die weitergeht und lebt. Grandiose Musiker.
Volkskultur als Begriff ist schwer einzuordnen und wird vielleicht daher belächelt. Heimat finde ich da auch ein schöner Begriff für ihre Beschreibung.
Ambäck? Natürlich kenne ich die – wer sich ernsthaft mit zeitgenössischer Volksmusik beschäftigt, kommt an Flückiger, Gabriel und Huber nicht vorbei. Ihre Musik ist ein Erlebnis: virtuos, wild, eigenständig – und dabei tief verwurzelt in der überlieferten Klangwelt des Muotathals. Gerade das macht sie so stark. Wer behauptet, Volkskultur sei museal, sollte mal Ambäck live hören. Da wird klar: Heimat ist kein Rückzugsort, sondern ein Resonanzraum für Neues. Und ja – es gibt zum Glück noch einige andere, die in diesem Spannungsfeld zwischen Tradition und Erneuerung unterwegs sind. Die Volkskultur lebt – trotz aller Stirnrunzler.
Schon faszinierend, wie sich der Herr Gautschin wunderbar selbstbestätigen kann. Ds braucht die museale Volkskultur gar keinen Resonanzraum für Neues mehr.
Super Artikel, Herr Gautschin, danke.
Ich erlebte übrigens in Burgdorf dasselbe wie Sie… ich wohne hier.
B. ist halt schon ein ganz spezielles „Pflaster“. Die Regierung ist mehrheitlich links. Somit erklärt sich auch die Geisteshaltung.
Das Ländliche belächelt man lieber – das Vorbild ist Bern, Basel, Zürich.
Der Emmentaler hat ausgedient. Auch der Käse.
Ist doch alles gut.
Ich selber und die meisten meiner Generation können mit sowas nix anfangen, aber wir sind grosse Klasse im Gönnen und freuen uns, wenn es den Boomern Spass macht.
Grosses Kompliment!
Auch als „linker Nestbeschmutzer“ erlaube ich es mir, bei einem schönen Jodel, voller Melancholie und Naturliebe, ein Tränchen zu vergiessen. Zum Beispiel gehört „E plaagete Puur“, trotz seines altmodischen, frauenfeindlichen Rollenbildes in den Pantheon der Volksmusik und gehört keinesfalls in eine hintere, braune Ecke verbannt.
Die Volkskultur ist mir lieb und heilig – Es sind deren verbohrte Vertreter und Verfechter, die mir häufig auf den Sack gehen… (Ähnlich geht es mir mit der Religion…)
P.S.: Höre jetzt Ambäck auf Spotify. Hammer. Danke für den Tipp!