Die Volksschule gilt seit dem 19. Jahrhundert als Errungenschaft: Bildung für alle Kinder – unabhängig von Herkunft, Stand oder Religion.
Noch im 18. Jahrhundert war Lernen ein Privileg der oberen Schichten. Erst die liberalen Kantonsverfassungen machten Bildung zur öffentlichen Aufgabe.
Doch von Anfang an war die Schule mehr als ein Ort der Wissensvermittlung. Ihr zweiter Zweck: staatsbürgerliche Tugenden einüben, Systemtreue verankern.
Kinder lernten, Autorität anzuerkennen, Pflichten zu erfüllen, sich dem Kollektiv unterzuordnen. Aus freien Individuen wurden verlässliche Bürger.
Die Volksschule war stets ein Instrument der Nationenbildung, kein neutraler Raum für ganzheitliche Persönlichkeitsentfaltung.
Das alte Schulmodell – Reih’ und Glied, Disziplin, Auswendiglernen – ist Geschichte, und doch lebt sein Geist weiter.
Auch heute dominiert Taktung: Lektionen, Tests, standardisierte Vorgaben. Kinder werden seriell unterrichtet, nach Jahrgängen sortiert, nach einheitlichen Kriterien bewertet.
Die zentrale Frage: Fördert dieses System tatsächlich individuelle Talente – oder formt es Kinder für die Interessen von Staat und Wirtschaft?
Johann Heinrich Pestalozzi forderte Bildung für „Kopf, Herz und Hand“: ganzheitlich, menschlich, praktisch.
Sein Name fällt oft in Sonntagsreden, doch die schulische Realität bleibt davon weit entfernt. Lehrpläne orientieren sich zunehmend an ökonomischer Verwertbarkeit. „Kompetenzen“ ersetzen Bildung; PISA ersetzt Neugier.
Lernen verkommt zum Training für Tests. Kreativität, Eigenständigkeit, Musisches – alles Randfächer.
Viele Lehrpersonen berichten, dass gerade das verloren geht, was Kinder am Lernen begeistert. Das Entdecken, Gestalten, Staunen.
Die Bildung reduziert sich auf das Abarbeiten von Stoff. Offiziell sind die Schulen kantonal geregelt. De facto aber geben politische Gremien und wirtschaftliche Interessen die Richtung vor.
Das zeigte sich beim HarmoS-Konkordat ebenso wie beim Lehrplan 21. Beides versprach Fortschritt, führte aber vor allem zu Vereinheitlichung und Bürokratie.
Die Wirtschaft reklamiert MINT-Fächer, um den „Standort Schweiz“ zu sichern. Auf der Strecke bleiben musische und handwerkliche Kompetenzen.
Ausgerechnet jene, welche Kreativität und Identität stärken würden.
Die Schule wird zum verlängerten Arm des Arbeitsmarkts. Im Zentrum steht nicht mehr das Kind, sondern der zukünftige Arbeitnehmer.
Früher war der Dorflehrer eine prägende Persönlichkeit. Heute ist die Lehrkraft Teil eines Apparats, dessen Hauptaufgaben lauten:
Lehrplan erfüllen, Tests bestehen, Administration bedienen.
Viele Lehrpersonen fühlen sich fremdgesteuert. Wo einst Pestalozzi die Freiheit des Lehrers betonte, herrscht nun Formularpflicht.
Das Ergebnis sind Burnouts statt Berufung. Kein Wunder, dass immer weniger Menschen Lehrer werden wollen.
Kinder lernen früh, dass Leistung alles ist; ein Menschenbild, das nachwirkt. Anpassung schlägt Neugier; Konkurrenz ersetzt Kooperation.
Der Druck, ins Gymnasium zu gelangen, spiegelt das schweizerische Statusdenken. Bildung wird zur Eintrittskarte für soziale Aufstiege, nicht mehr zur Möglichkeit individueller Entfaltung.
Die Berufslehre, einst Stolz des Landes, gilt vielen Eltern nur noch als zweite Wahl. Das Schulsystem liefert jene Haltung, die später im Arbeitsleben dominiert: Funktion vor Persönlichkeit.
Kaum ein Bereich wird so oft reformiert und bleibt zugleich so unverändert. Neue Lehrmittel, neue Konzepte, neue Etiketten – das Prinzip bleibt gleich: zentral gesteuert, wirtschaftlich verwertbar, pädagogisch kastriert.
Solange Bildung Mittel zum Zweck bleibt und kein eigentlicher Lebensbereich, bleibt sie unfrei. Eine Schule, die ihre Richtung aus Systeminteressen statt aus dem Kind schöpft, kann keine Erneuerung leisten.
Die Schweiz verehrt Pestalozzi und ihre direkte Demokratie. Beide leben vom Geist der Selbstverantwortung.
Eine freie Gesellschaft braucht Menschen, die denken, nicht bloss funktionieren. Eine Schule, die Kinder zu angepassten Leistungsträgern erzieht, sichert vielleicht die Wettbewerbsfähigkeit – aber nicht die Zukunft.
Die zentrale Frage bleibt: Wollen wir Kinder passend machen für ein System, das morgen schon überholt sein kann? Oder helfen wir ihnen, Menschen zu werden, die ihre Zukunft selbst gestalten?
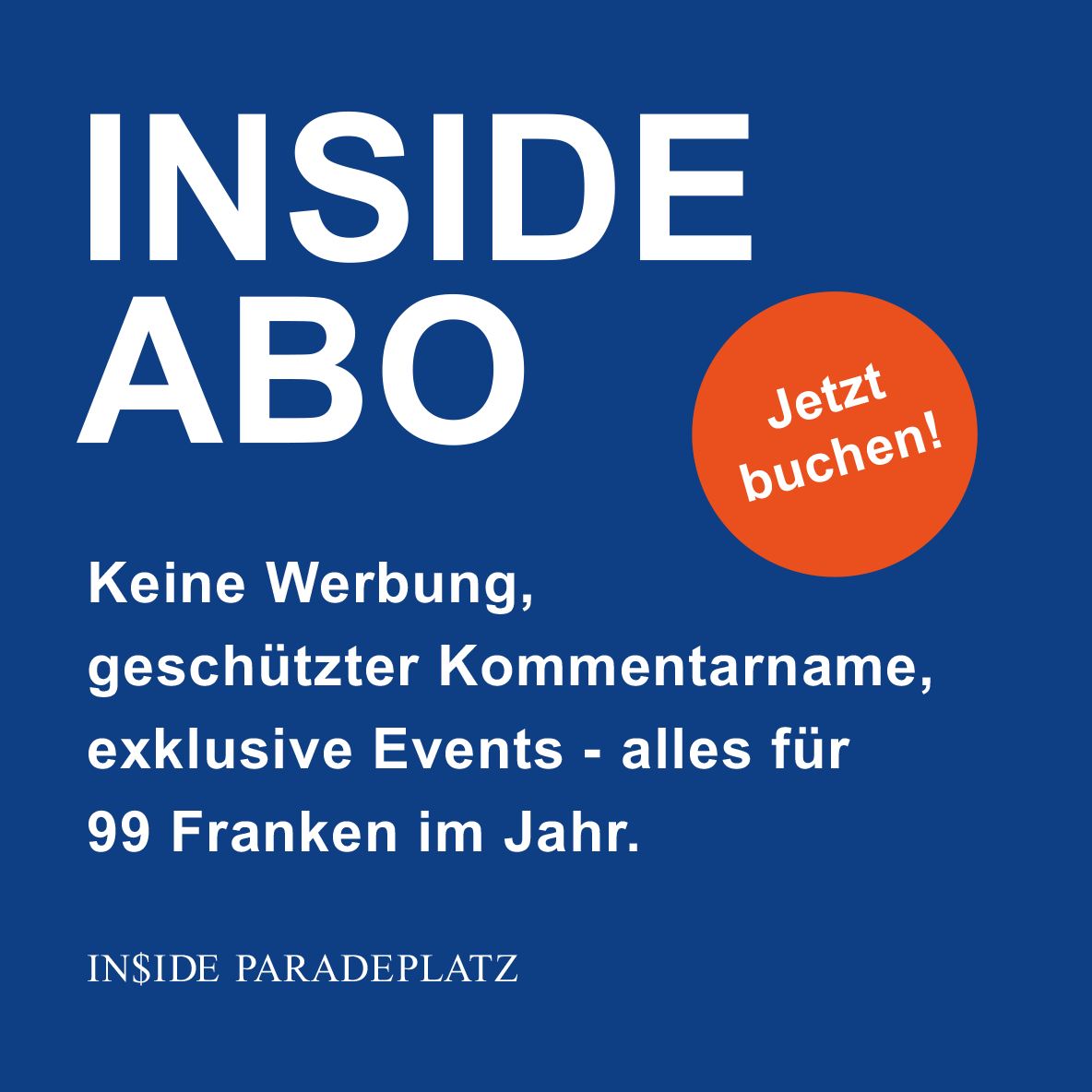
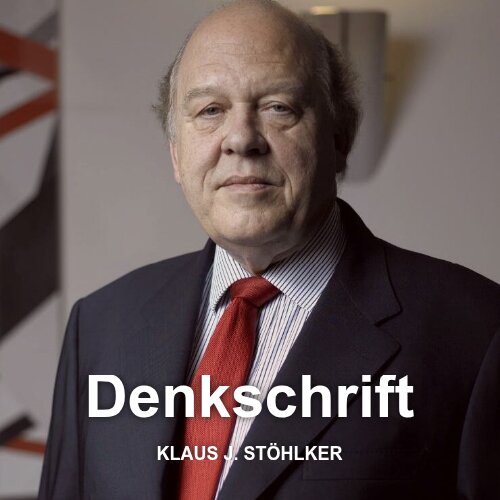
Sehe geehrter Herr Gutschin herzlichen Dank für Ihre Recherche. Sie und Herr René Zeyer Betreiber von http://www.zackbum.ch und Herr Stöhlker und Herr Presta (alle in meinem *LTDRS*) ABER Sie haben auch GELEISTETnuxht nur und ich mag Ihren Mix zwischen Recherchen (Fremdwort für 20Millisekunden… 😉] uns Marmor bitte bleiben Sie auf http://www.insideparadeplatz.ch Hans Gerhard
Herr Gutschin for president of the USA;-)
„Lehrpläne orientieren sich zunehmend an ökonomischer Verwertbarkeit. „Kompetenzen“ ersetzen Bildung; PISA ersetzt Neugier.
Eine freie Gesellschaft braucht Menschen, die denken, nicht bloss funktionieren.“
Ich empfehle dem Autor einmal die Kommentare zu lesen, was man in diesem Land über gewisse Studiengänge denkt.
Der allgemeine Tenor ist: Wozu braucht man diesen Quatsch? Reine Steuergeldverschwendung.
Ich in einer Konferenz: Was ist das Ziel der Schule, reife Staatsbürger oder Ingenieure hervorzubringen?
Das Problem sind nicht die Bürokraten, sondern die Mehrheit der Gesellschaft.
„ Das Problem sind nicht die Bürokraten, sondern die Mehrheit der Gesellschaft.“
Der Satz könnte genauso gut von Stalin stammen
Die Mehrheit der Gesellschaft?
Der Eigenmietwert wurde abgeschafft. Die Mehrheit ging an die Urne und überstimmte die selbsteingebildete Mehrheit der Medien!
Ich frage mich dann aber schon, wie es kommt, dass heutige Schulabgänger keinen geraden Satz mehr hinkriegen, geschweige denn, einen Satz ohne dutzende von Schreibfehlern schaffen.
Die Leute, welche das Schreiben nach Gehör unterstützten gehören auf den Scheiterhaufen.
Im zentrum steht der zukünftige AHV zahler/in, sonst nichts.
Wiedermal PINK FLOYD „The wall“ auflegen. Sozusagen ein Back to the future – Erlebnis … offenbar ist grad „E“ oder schon „H“ Schweiz auf der Brücke.
Ich bin für einmal mit Ihnen vollständig einverstanden, Herr Gautschin. Dabei hat geholfen, dass Sie das Thema ohne den in Ihren Beiträgen sonst nicht wegzudenkenden kulturkämpferischen Sturm und Drang behandeln – aber wir können ja darauf vertrauen, das dies in dieser Kommentarspalte andere unvermeidlich übernehmen werden.
Ich habe keine Lösung – stelle aber fest, dass grundlegende Fertigkeiten fehlen. Derweil erschöpfen sich die „Kompetenzen“ darin, schlecht PowerPoint-Präsis zu halten. Am Engagement der Lehrer liegt es nicht – Chapeau für deren Leistung. Die Menge der Ansprüche ist zu viel.
Die Lösung ist, die Schweiz muss aus der UNO austreten, dann kann wieder ein vernünftiger Lehrplan ausgearbeitet werden und gelernt werden.
Gleichförmige Schafe – das ist doch genau was unser SVP, AfD, FPÖ, Fratelli und Le Pen wollen, oder ? Wenn zu viele Leute eigenständig denken würden dann gäbs ein Chrüsimüsi und niemand würde drauskommen, was eigentlich giltet.
Ganz genau. Das sieht man hier in den Kommentaren sehr schön. Da plappern die SVP-Schafe jeden noch so grotesken Blödsinn nach, den ihre Vordenker vorplappern, und sie verstehen sich dabei als „Selberdenker“. Hauptsache, es ist gegen den „Main-Stream“ (oder „Lame-Stream“). Und gerade, wenn penetrant immer hervorgehoben wird, dass man „selber denke“, dann ist ist genau das eben nicht der Fall. Das gilt übrigens in ähnlicher Weise für linksextreme selbsternannte „Intellektuelle“.
Die meisten dieser Sesselfurzer Stellen könnten abgeschafft werden. Wartet nur mal ab bis die KI richtig eingesetzt wird, dann werden viele dieser Stellen in der Privatwirtschaft abgeschafft. Natürlich bei den Regierungen wird man noch mehr Kontrollstellen zum Überwachen der KI und der Bürger schaffen. Die KI müsste dringend in der Politik eingesetzt werden, Resultat 90% der Politiker sind unnütz und korrupt. Ein Handwerk lernen wird Zukunft haben.
Thiel hat in den vergangenen Wochen seine sämtlichen Anteile an nvidia verkauft.
passt doch so.
für die nächste Testpandemie.
Ups! Zutief ins Glas geschaut?
Heutzutage muss vom Studieren abgeraten werden. Der staatlich finanzierte linke Mainstream lässt die Mehrheit in realitätsfremde Unselbstständigkeit abgleiten.
Lieber keine Bildung, als linke Bildung!
Die von unseren Bildungsbürokraten kaputtorganisierte Volksschule mit dem politischen Ziel der Nivellierung nach unten ist die grösste innenpolitische Baustelle der Schweiz.
Und ich glaubte immer, das grösste innenpolitische Problem sei das Ständemehr.
Aktuell findet (auch) auf Gymi-Stufe mit der „Weiterentwicklung der gymnasialen Matur“ eine drastische Nivellierung nach unten statt. ZH reduziert die Mathelektionen um 6% (von 16L auf 15L für 4 Jahre). SZ wenn’s böse kommt um 12.5% (von 16L auf 14L), 25% weniger Lektionen in naturwissenschaftlichen Fächern in gewissen Bereichen. So geht MINT-Förderung heute….
Marcel Dettling braucht eben keine Physiker.
Einverstanden. Und mit KI verkommt alles noch zum Einheitsbrei. Wieso werden Kinder immer früher eingeschult? Sie verpassen ihre Kindheit, in dieser Freiheit, Kreativität, Fantasie, Neugier, Entdeckung zur normalen Lebenserfahrung gehör(t)en, nur weil der Staat die Kinder schon „ab der Wiege“ in unsere Gesellschaftsstruktur und -Regeln einpferchen will. Und mit den „Screens“ vor Augen, wird das Denken zusätzlich noch eingeschränkt. Unsere Leistungsgesellschaft macht sich IT-abhängig selber kaputt. Roboter werden sie ersetzen. Und wie wird die Natur damit umgehen? Sie hat ihre eigenen Regeln.
Frühfranzösisch als Vorbereitung des Staats auf die TicToc-Konsumgesellschaft, die wir für unsere Kinder geschaffen haben?
Wenn ich Jung wäre, ich wüsste nicht was ich werden sollte. Studieren bringt es ncht mehr. Die Löhne sind schlecht für das lange Studium. Die Löhne nach der Lehre sind noch schlechter. Die Firmen gehören oft Ausländern. Will man für die arbeiten?
Das was noch am besten ist, ist auswandern und selbständig in einem anderen Land werden wo die Währung noch Kaufkraft hat. Aber nicht alle können auswandern, das ist sehr aufwändig und braucht viel Energie.
🏆🏆🏆Vollständig individualisierte „Wissensvermittlung“ via persönlichem KI AssistenzLehrer, reduziert die Lernzeit von 100 auf 30% hinunter (TestSchulen / Peervergleiche). Die Kids lernen plötzlich sehr gerne, motiviert, modern equipped und sehr effizient, quasi selbständig, im eigenenTempo
Die viele, eingesparte Zeit wird dann für mehr Schulsport, Musik, Natur & Ernährung, Hilfsprojekte bei der Community/Gemeinde eingesetzt. SEHR SINNVOLL für die Zukunft der JUGEND ! Und günstiger für alle.
Boomer!
Unsere individualisierte Gesellschaft ist auf dem absteigenden Ast und funktioniert als Kollektiv nur noch dann, wenn es etwas zum Motzen gibt. Wenn eine Gesellschaft angenehm funktionieren soll, dann brauchen wir weniger Frust und mehr Zufriedenheit. Die nordischen Länder haben das erkannt und beginnen das Schulsystem radikal zu ändern, um diese Punkte, welche im Artikel beschrieben sind, aufzufangen. Und dieses Umdenken muss unsere Wirtschaft und eine bestimmte Lehrerkaste noch lernen.
Unser Schulsystem nimmt kein Rücksicht auf Talente, Lerntyp und den individuellen Tagesrhythmus der Kinder. Alle werden nach dem gleichen Schema unterrichtet Dadurch „lernt“ man vielen Kindern vor allem, unangenehme Situationen auszuhalten. Freude, Neugier und die vertiefte Auseinandersetzung mit eigenen Interessen bleiben auf der Strecke.
Gleichzeitig zwingt das System alle in dieselbe Form: Praktisch oder handwerklich begabte Kinder müssen sich überwiegend mit Theorie herumschlagen. Mathematische Talente verlieren Zeit mit intensiven Sprachübungen und umgekehrt. Schade.
Stimmt nicht. Kinder, welche keine der Landessprachen sprechen erhalten Lernförderung. Auch indem schweizer Kinder ausgebremst werden.
Machst du ernsthaft Kinder, die die lokale Sprache nicht sprechen, dafür verantwortlich, dass „Schweizer“ Kinder ausgebremst werden?
Es war schon immer so, dass Pädagogen sich mit möglichst skurrilen Lern- und Lehrideen (a.k.a. „Lehrpläne“) selst verwirlkichen wollten. Es kam bislang grundsätzlich immer nur eine Verschlechterung heraus.
Das Bologna-System war dann das erste grosse „Downsizing“ der Hochschulausbildung. Heute hat jeder und jede einen Bachelor oder einen Master. Erst ein Nachfragen ergibt dann, dass dieser in der Bäckerei Hugentobler erworben wurde.
Das Dünnste sind jedoch die Multiple-Choice-Fragen an Hochschulen. Eine reine Faulheit der „Professoren“. Sie machen die Prüfung zur reinen Lotterie.
Haben Sie solche Prüfungen absolviert ernsthaft ?
Ist schwieriger als mündliche Prüfung.
Habe beides dutzendfach erlebt.
Die Kritik ist kein Pessimismus. Sie ist eine Erinnerung daran, wofür Bildung eigentlich da ist:
Nicht für Unternehmen.
Nicht für den Staat.
Nicht für Rankings.
Dass die Schule von heute durch die Harmonisierung weniger die persönliche Entfaltung und die Begeisterung fördert, ist unbestritten. Jedoch kann es doch nicht sein, dass Musik oder Zeichnen zu einem derartigen Selektionsfach werden, dass Schüler deswegen ein Jahr wiederholen müssen. Zudem kommen immer mehr junge Menschen in den Arbeitsmarkt, die in Deutsch keine E-Mail ohne diverse Fehler schreiben können, denen die grundlegenden Kenntnisse in Mathematik fehlen oder die keinen Kaffee in Französisch oder Englisch bestellen können! Wozu denn überhaupt so lange in die Schule gehen?
Für den Furz Frühfranzösisch & Frühenglisch wurden Stunden in Handarbeit und Werken abgebaut.
Talente werden schon lange nicht mehr gefördert. Dafür werden endlos Geld und Ressourcen in die Förderung von schlicht Untalentierten gebuttert. „Chancengleichheit“ nennt sich das Ganze. Jeder soll studieren können… Den echten Talenten wird so die Freude genommen.
Entdecken, Gestalten, Staunen geht erst wenn man Lesen, Schreiben und Rechnen kann. Basics, und die müssen reingepaukt werden. Das war schon immer so!
Wie kommst du auf die Idee, das Ziel wäre, dass jeder studieren sollen könne?
Es ist bemerkenswert wie viel mehr Charakter Lehrlinge haben, im vergleich zu Gymnasiasten. Das Gymi ist die Feminisierung unserer Jugend unter dieser Bürokratie
Oh Gott! Wachsen den Gymnasiasten jetzt schon Brüste? Das ist ein Fall für Dr. Schlittler!
Die Ausbildung ist bereits von der Gynarchie gesteuert. In der Primarschule wird „ weibliches“ Denken und Sprache eingeübt, political correctness, Gendersprache um dann in der Hochschule zu perfektionieren. In der Berufswelt ist das Personalbüro weitestgehend von Frauen kontrolliert, welche dafür sorgen, dass die zweite Führungsebene von Frauen besetzt wird, um dann mittels Intrigen das oberste männliche Leitungsorgan zu beherrschen oder wegzumobben.
Die Frauenorganisationen beherrschen die Methoden und Kommunikation und wissen, wie man die Macht ausübt. In der Kita/Schule beginnt es.
Wer beherrscht denn dein Leitungsorgan, Tamann?
Ueberall Bildungslücken, fehlende, kompetente Lehrer und eine bedenklich schlechte, linke Bildungsindustrie. Die Masseneinwanderung in unsere Sozialwerke und die Einwanderung aus bildungsfernen Regionen der Welt zeigt immer mehr und immer häufiger den Zerfall der CH- ja ganz Europas. Linke Gaga- und Woke-Parteien nicht mehr wählen ist die einzige Lösung.
Ja, Klartexter. Geh jetzt wieder rein.
Sie meinen rein in den linken Saftladen und die linken Bildungskräfte weiter wursteln lassen mit ihrem gescheiterten Lehrplan 21, Gudenus?
Ich kenne aus der Schule vorallem die Fischli- und die rechten Lehrernetzwerk-Bildungskräfte, nachdenklicher Bürger. Scheinbar machen sie eben doch nicht so einen guten Job. Aber wenigstens beten sie.
Im Lehrplan 21 und bei der Bologna-Reform geht es nicht darum unsere Kinder, alles individuelle Menschen, dabei zu unterstützen selberdenkende, selbstbestimmte Individuen zu werden.
Beispiel: im LP21 ist die Kompetenz in den Grundrechenoperationen erreicht, wenn diese auf einem Rechner ausgeführt werden können – Kopfrechnen unnötig!
Mittlerweile offensichtlich haben diese das Ziel unsere Kinder zu Robotern abzurichten. Sind ja, inkl. Studium, besser indoktrinierbar so.
Offenbar wollen wir das ja so?!
Deine Aussage ist falsch, Mike.
https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=a%7C5%7C0%7C1%7C1%7C3
👉Der LP21 ist im Jahre 2010 entstanden ! Die Fächer/Anteile wurden deshalb ja nur auf die DAMALIGEN Berufsbilder (noch ohne Digi & AI, Robotic, Sensoric, KI allesÜberseter, VR, AR, etc)
ausgerichtet. Ist bist heute immer noch +/- gleich. Einfach die vielen Bücherumschläge wechseln in 26 Kt anders gedruckt, dauernd. Sonst hat sich ausser den neuenProblemen (inhaltlich) so ziemlich nichts geändert. Seit 2010. Trotz riesigem
Bildungsmoloch von A-Z. Riesiger CH Schlafwagen, auf dem alten, analog Abstellgeleise wartend.
Deine Aussage stimmt so nicht, Mike. Die Schüler müssen nicht nur auf dem Taschenrechner rechnen können. Ein Blick in den Lehrplan zeigt das ohne grossen Aufwand.
@Lorenz Gangner
siehe Grundkompetenzen FÜR DIE MATHEMATIK
Nationale Bildungsstandards | Frei gegeben von der EDK-Plenarversammlung am 16. Juni 2011
Worauf beziehen Sie sich?
Wenn man will kann man natürlich zudem auch Untersuchungsresultate ignorieren, welche eine deutliche Verschlechterung der Leistung in der Mathematik nach der Einführung von Computern feststellen?!
@Mike: https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=a%7C5%7C0%7C1%7C1%7C3
Ca 3-4 Jahre vergehen bis ein neues LP21 Lehrbuch auf den Beinen steht.
Dann müssen sämtliche Lehrer, Stv, Vikare etc noch darauf geschult werden, damit sie dann mit den schon mind 4 Jahre alten Büchern das neuste der Welt den Kids beibringen. Auf moderne, CO2 arme Art und Weise. Serviert von jungen
dipl.Pädagogikspezialisten, welche 0 Ahnung von der Jobwelt/Wirtschaft haben. Woher auch. Zum Glück haben wir Quereinsteiger im Lande. Die werden jedoch auch an die alten Inhalte/Bücher gebunden.
Dass man seitens der PHs und den ErziehungsDeps., keine öffentliche (!) Diskussion führt zum Thema: – 🇨🇭GesamtTempo/Fächer/Digibildung resp Einsatz von AR u. VR als perfektes, günstiges Visualisierungs Tool/s für die heutigen Kids – ist mir als Dipl.Pädagoge ein sehr grosses Rätsel. Die PHZH hat jetzt im Jahr25, doch neu, ein sog. „Innovation Lab“. Zusammen mit der ZKB (Bank ???) aufgebaut. Erste Tests u xyStudien mit dem neuen VR. VR Brillen brauchen die Kids & Studenten aber schon seit 10 Jahren – einfach zum gamen (War Games…BIG BUSINESS). Selber nutzen für unsere Bildung? Fehlanzeige!
Hat nicht eine ZHFirma Evulpo (?) den LP21 schon längst digitalisiert? Inhalt ist online und jetzt per AI in jede erdenkliche Landessprache gratis übersetzt ? Selbst alle ausländischen Sprachen sind auch gleich gratis mitübersetzt (Flüchtlinge). D.h wir haben/hätten eigentlich schon alles ready to go. Einfach 2136x unterschiedlich.Cool. Gut & beruhigend zu wissen. Als Eltern.
Vektor: mal noch 2 Jahre warten, bis die erste grosse Wave nach 2 Jahren RAVAdmin, dann ev. bei den Gemeinde/Soz., realisiert, dass es ihren Beruf so gar nicht mehr geben wird, resp. dass er sich völlig verändert/digitalisiert hat. Dann kommt die heftige Frage, direkt an die junge zT naive Lehrer/innen Front: was der alte LP21x9 Jahre Grundschul ab 2027 noch soll. Ist ja jetzt schon absehbar. Nochmehr Augen zu und Wegdenken“ geht bald nicht mehr.
Es war der Pisa-Schock, der den Stein ins Rollen brachte. Profilierungsmöglichkeiten für Politikerinnen, für Erziehungswissenschaftlerinnen, für Teamberater, für Lehrerinnencoachs, für Sozialarbeiterinnen, für Klangschalentherapeutinnen, für Organisationsberater, für Retraitengestalter und Schulleitungen. Die Lehrerinnen wurden beschallt mit Reformen rund ums Schulzimmer. Vergessen wurde dabei die Arbeit im Schulzimmer. Dafür blieb immer weniger Zeit vor lauter Sitzungen im Team als Zelebration von Plaudern als Selbstzweck. Kein Wunder verstehen viele Schulabgänger einfache Texte nicht.
Yeap – BINGO. Und jede einzelne Lehrmittelzentrale des Kantons, druckt schon Bücher bis ins Jahr 2029 (?!?). PHs & jede Gemeinde sind dann quasi gebunden/ gezwungen, damit zu „arbeiten“, resp. diese per Kt.Zwangspflicht zu bezahlen/beziehen. Alle Leitplanken noch basierend auf dem LP21/2010. Kt. Cash Machine mit veralteten Produkten – auf grossen Vorrat. Crazy!
1 Jahres (Wegwerf)Bücher, pro Kind & Fach
Viele Lehrer sind keine richtigen Lehrer, es sind vielmehr gut verdienende Agitproper, die vom Kanton auf unsere Kosten auf unser Kinder losgelassen werden.
Siehst du, gütiger, du bist halt nur ein schlechtverdienender Agitproper. Aber immerhin nicht vom Kanton finanziert.